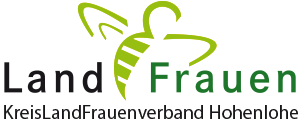Prolog
Keine Ruhe finden kann ich. Auf der Suche bin ich, immer und immer und kann nicht ruh ‘n. Kann es nicht verwinden, was sie mir angetan. Mich trifft keine Schuld.
1. Kapitel
Da liegt sie. Ich kann sie sehen und spüren, aber nicht berühren. Sie findet keinen Schlaf und keine Ruhe. Wie gern würde ich ihr helfen. Doch sie kann es nur aus eigener Kraft tun. Sie hat einen Weg vor sich, einen langen und schweren. Jung ist sie, ohne viel Erfahrung. Rastlos ist sie. Unabhängig möchte sie sein, doch sie ist weit davon entfernt. Es fällt ihr schwer, sich zu lösen und freizumachen. Sie glaubt an die Liebe, doch kennt sie die Liebe? Ich kann sie verstehen. Ich kann nachempfinden, wie es ihr geht. Ach, wie nahe fühle ich mich ihr. Vielleicht sollte ich ihr meine Geschichte erzählen.
Als Liz den Brief aus dem Briefkasten fischte, spürte sie, wie ihre Hände vor Aufregung zitterten. Ihr Herz schlug bis zum Hals, als sie ungeduldig mit dem Finger eine Ecke des Umschlags aufbohrte und ihn hektisch aufriss. Endlich … die lang ersehnte Nachricht vom Schulamt … ihre erste Stelle als frisch gebackene Lehrerin. Nun würden sie zusammenziehen, Marcel und sie, eine schicke Wohnung in der Stadt würden sie sich suchen, vielleicht sogar mit Dachterrasse, das hatte sie sich schon immer gewünscht. Das Zimmer in der WG war für die Zeit des Studiums und auch während des Referendariats wirklich eine super Lösung gewesen; bezahlbar, zentral gelegen, fast immer war jemand da, wenn man reden wollte, abends noch einen Absacker trinken, sich auskotzen, wenn man frustriert war, sich eine zweite Meinung zu einer geplanten Unterrichtsstunde einholen. So eine WG hatte große Vorteile. Aber jetzt sehnte sich Liz nach ihren eigenen vier Wänden. Sie war zweimal umgezogen während des Studiums. Zuerst in ein Wohnheim, dann in eine große WG. Da hatte es nicht funktioniert, weshalb sie vor drei Jahren dann in diese kleine WG gezogen war. Vier Zimmer, eine große gemeinsame Küche, ein gemeinsames Bad. Es hatte von Anfang an gut funktioniert. Lauter Lehramtsstudenten waren sie gewesen.
Liz hatte sich bemüht, einen guten Abschluss hinzulegen, damit sie hier in Karlsruhe bleiben konnte. Welche Schule es wohl werden würde? Eine Schule am Stadtrand von Karlsruhe wäre gut, dachte sie, Innenstadt müsste nicht unbedingt sein. Ihr Notendurchschnitt war gut. Aber vielleicht nicht gut genug. Sie hatte eine Lehrprobe in den Sand gesetzt, nur eine „befriedigend“ bekommen. Eigentlich sollte es trotzdem knapp reichen. Karlsruhe war beliebt. Wer dort studiert hatte, wollte meistens bleiben. Liz überflog das Schreiben ein zweites Mal. Sicher hatte sie sich vertan. Ihre Augen begannen zu flackern, die Schrift verschwamm. Da stand nirgendwo etwas von Karlsruhe. Sie schaute noch einmal genauer hin. Nein! Das konnte nicht sein. Ihr Atem stockte. Noch einmal lesen, genauer lesen, zwang sie sich, doch sie merkte, wie sich ein Tränenschleier über ihre Augen legte, der nicht einmal durch heftiges Blinzeln wegzuwischen war. Schulamt Wiebittewo? Künzelsau? Wo war das denn? Das war doch … war das nicht in Hohenlohe? War das nicht da, wo keiner hinwollte? Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten? Jwd, janz weit draußen? Wo die Menschen einen Dialekt sprachen, den man nicht einmal erlernen konnte, so verquer war der? Das konnte nicht sein. Ihre Noten waren doch gut gewesen, sehr gut sogar. Weshalb sollte dann ausgerechnet sie…nach…wohin genau? Der Schulort … diesen Namen hatte sie noch nie gehört: Mulfingen, eine Grundschule anscheinend, so stand es da schwarz auf umweltschutzgrauem Papier. Zitternd ließ sie die Hände sinken. Der Briefbogen mit der Hiobsbotschaft segelte zu Boden. Liz spürte eine Welle der Wut in sich hochsteigen. Sie setzte sich in ihren grauen Sessel, ihren geliebten Sessel, den sie von ihrer Großmutter zum Abitur bekommen hatte, als Erbstück vom Opa; der Sessel, in dem sie gelesen, gelernt, gechillt und geschlafen hatte, der sie durch ihr gesamtes Studium begleitet hatte, den Marcel kitschig und altmodisch fand und der, wenn es nach ihm ging, auf keinen Fall mit in die neue schicke gemeinsame Wohnung durfte. Doch jetzt schien alles anders zu sein. Mit einem Schlag, mit nur einem Satz, gedruckt auf graues Papier, mit einer Stelle an einem Ort, von dem sie nicht einmal wusste, wo er überhaupt war!
‚Ich google das jetzt‘, dachte Liz, ‚wo dieses Mulfingen ist.‘ Das Ergebnis war niederschmetternd schnell da. 150 km, peitschte ihr die Entfernung in’s Gesicht. Rund zwei Stunden einfache Strecke. Das konnte man unmöglich pendeln. Nicht, wenn es Elternabende und Konferenzen gab. Liz stöhnte. Das durfte doch alles nicht wahr sein. ‚Habe Nachricht vom Oberschulamt bekommen,‘ tippte sie eine WhatsApp an Marcel. Mit weinendem und verzweifeltem Emoji. Zwei schwarze Haken, Nachricht empfangen, aber bis er es lesen würde, konnte es dauern. In der WG waren alle ausgeflogen. Keiner war da, mit dem man das mal eben bequatschen konnte. Ferien eben. Liz schrieb an ihre beste Freundin. Eva antwortete sofort. ‚Waaaas? Bist du sicher, dass keine Verwechslung vorliegt?‘ ‚Kann ich kurz anrufen?‘ ‚Klaro‘ mit Daumen-Hoch-Emoji. Eva war eine geduldige Zuhörerin, Seelentrösterin und Mutmacherin. Sie hatte direkt mehrere Vorschläge für Liz: Erstens Anruf beim Schulamt, um nachzufragen, wieso und weshalb, ob es sich vielleicht um eine Verwechslung handelte. Zweitens den Ort Mulfingen zumindest mal anschauen. Drittens überlegen, ob Marcel auch dort in Hohenlohe eine Stelle finden könnte. Viertens im größten Notfall die Stelle ausschlagen und sich auf die Warteliste setzen lassen, bis in Karlsruhe direkt was gesucht würde und solange als Krankheits-Vertreter zur Verfügung stehen. Da brauchte man immer Lehrer. „Danke, Eva, du bist ein Schatz!“, beendete Liz das Sorgentelefonat. Dass Eva direkt von ihrer Ausbildungsschule übernommen wurde, erfuhr Liz in einem Nebensatz am Ende des Gesprächs. Und das fühlte sich komisch an. Auch wenn sie es ihrer Freundin wirklich gönnte, es tat weh. Ein kleiner, fieser Stachel bohrte fragend: ‚Warum funktioniert es bei ihr? Warum muss sie nicht weg?‘ Liz versuchte, nicht länger darüber nachzudenken. Sie wollte nicht neidisch sein, aber sie spürte, dass sie es doch war. Ruhelos schritt sie in ihrem Zimmer auf und ab, ging in das Bad, das eigentlich dringend mal wieder geputzt werden müsste, aber sie war diese Woche nicht dran. Außerdem hätte sie im Augenblick gar nicht die Kraft, etwas Sinnvolles zu tun. Der Blick in den Spiegel zeigte ihr ein blasses Gesicht voller Sommersprossen, rötliche, lockige Haare, die sich widerspenstig aus dem Pferdeschwanz zu lösen begannen. Liz zwang sich, tief durchzuatmen, schüttete sich kaltes Wasser ins Gesicht, ging zurück in ihr Zimmer. Blick aufs Handy: Marcel hatte die Nachricht immer noch nicht gelesen. Dass er auch immer so furchtbar korrekt sein musste und sein Handy am Arbeitsplatz konsequent in der Schublade ließ. Mit viel Glück schaute er in der Kaffeepause mal drauf. Liz überlegte, ob sie mit ihren Eltern telefonieren sollte, aber sie entschied sich dann für die Warteschleife auf dem Schulamt. Nervös kaute sie auf den Fingernägeln. Das hatte sie sich eigentlich abgewöhnt. Offenbar hatten viele andere genau zur selben Zeit ein dringendes Anliegen, denn Liz musste lange warten. „Oberschulamt Karlsruhe, Sie sprechen mit…“ Endlich! „Ähm, guten Tag, Elisabeth Breitner, ich habe eine Frage zu einem Schreiben, das ich heute vom Oberschulamt bekommen habe.“ „Ja, worum geht es denn?“ „Also, ich habe offensichtlich eine Stelle in Hohenlohe bekommen und wollte…“ „Was ist das Problem?“ „Ich wollte eigentlich hier in Karlsruhe bleiben“, sagte Liz mit trockenem Mund. „Kann man da gar nichts mehr tun?“ „Sie sollten froh sein, dass Sie direkt übernommen werden. Aber Sie müssen die Stelle ja nicht annehmen. Melden Sie sich arbeitslos oder lassen sich als Krankheits-Vertreter auf die Liste setzen. Vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr.“ Liz schluckte. Hatte nicht Eva genau das vorgeschlagen? Sie spürte, dass auf dem Amt nichts zu machen war, bedankte sich bei der Dame am anderen Ende der Leitung und legte auf. Immer noch keine blauen Haken bei Marcel. Wenn man ihn brauchte, war er nicht greifbar. Die Gedanken in Liz‘ Kopf drehten sich im Kreis. Plötzlich klingelte ihr Handy. Als Liz auf das Display blickte, machte sich eine Welle der Erleichterung in ihr breit, und sie musste unwillkürlich lächeln: Oma Doro. Die schien immer zu spüren, wann sie gerade dringend gebraucht wurde. Und bei Oma Doro musste Liz ihre Tränen nicht länger zurückhalten, die eigentlich die ganze Zeit schon gedrückt hatten. „Und Eva darf hier in Karlsruhe bleiben“, schniefte Liz, „und Marcel und ich wollten doch endlich zusammenziehen…“ „Das könnt ihr doch trotzdem tun, Liz. Dein Marcel findet sicher auch in Hohenlohe eine Stelle. Da gibt es viele große Firmen.“ „Ach was, niemals. Das kannst du erden“, schluchzte Liz. „Marcel geht nicht aus Karlsruhe weg. Er ist happy mit seinem Job, da passt einfach alles für ihn, das hat er neulich erst gesagt. Das wird eine Wochenend-Beziehung…Ach, Oma, was soll ich denn in Hohenlohe? Wer will da schon hin?“ „Also hör mal!“, empörte sich Oma Doro, „weißt du denn nicht, dass Heilbronn schon ganz in der Nähe von Hohenlohe ist? Hier bei mir hat es dir doch immer gut gefallen.“ „Heilbronn ist zumindest eine Stadt, Omi,“ heulte Liz. „Ich hab mir das auf Google Earth angeschaut, da ist nichts, weit und breit ist es da nur grün…“ Oma Doro wollte wissen, wie der Schulort hieß. Und dann überlegte sie nicht lange und machte ihrer Enkeltochter einen Vorschlag: „Weißt du was, meine liebe Liz? Setz dich in dein Auto und komm deine alte Oma einfach besuchen. Ich habe die nächsten drei Tage keine Rentner-Termine. Und dann fahren wir zusammen in dieses Mulfingen und schauen es uns mal an, ganz unverbindlich. Hohenlohe ist ein unglaublich schönes Fleckchen Erde. Grün auf der Landkarte ist in der heutigen Zeit ein Segen. Vielleicht bist du noch zu jung, um das schätzen zu können. Aber gib der Sache eine Chance. Abgemacht?“ „Abgemacht“, willigte Liz ein. „Und…Omi?“ „Ja?“ Liz seufzte tief durch und sagte mit fester Stimme: „Danke!“ Sie konnte ihre Oma fast lächeln sehen. Dann klickte es, und Liz legte ebenfalls auf. Oma Doro hatte recht. Sie musste es sich zumindest erst einmal anschauen. Marcel hatte ihre Nachricht immer noch nicht gelesen. Worauf sollte sie noch warten? Liz warf wahllos ein paar Klamotten in ihre kleine Reisetasche, packte dazu, wovon sie annahm, dass sie es in den nächsten drei Tagen brauchen würde, schloss die Tür zu ihrem Zimmer in der Studenten-WG und hatte irgendwie das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Und so musste sie, als sie kurze Zeit später in ihrem alten Opel Corsa saß, auf den sie richtig stolz war, weil sie ihn sich von ihrem Referendarinnengehalt abgespart hatte, fast schon ein bisschen über sich selbst den Kopf schütteln. Als sie auf die Autobahn fuhr, kam gerade „Steh auf“ von den Toten Hosen. Liz kurbelte die Scheibe herunter, setzte die Sonnenbrille auf, drückte aufs Gaspedal und sang aus Leibeskräften mit. Das befreite fürs Erste.
Keine zwei Stunden später parkte sie ihren Corsa vor dem kleinen Reihenhaus in Heilbronn. Seit dem viel zu frühen Tod ihres Mannes wohnte Oma Doro alleine hier und fühlte sich hier sehr wohl. Sie hatte guten Kontakt zu den anderen Parteien in der Häuserreihe. Liz mochte die Wohnung ihrer Großmutter. Es gab ein kleines, gemütliches Gästezimmer, in dem ‚immer ein Bett für sie bezogen war‘, wie es ihre Omi zu sagen pflegte. Liz hatte kaum den Klingelknopf gedrückt, als Oma Doro schon die Tür aufriss und sie herzlich in ihre Arme schloss. „Liz, mein Schätzchen, komm erstmal rein. Trinken wir einen Tee?“ Liz nickte. Oma Doros Schwarztee mit Kandis und Rum war einfach unschlagbar gut und mit garantierter sofortiger Beruhigungswirkung. Was entweder am Rum oder an Oma Doro oder an beiden lag. Sie saßen auf der Terrasse, die ringsum voller üppigem Blumenschmuck war, von der Sonne mit einem großen Sonnensegel geschützt, und genossen die Aussicht auf die Weinberge. Oma Doro goss sich eine zweite Tasse Tee ein. „Weißt du, nach meiner Ausbildung musste ich auch den Wohnort wechseln. Da dachte ich anfangs, eine Welt bräche zusammen. Aber wäre ich nicht nach Heilbronn gekommen, hätte ich nicht deinen Opa kennen gelernt… und so manche Erfahrung nie gemacht.“ „Schon klar,“ murmelte Liz, „aber ich bin ja schon zum Studium von zuhause weg. Und jetzt hat es mir so gut in Karlsruhe gefallen…“ „Man sollte nie auf der Stelle treten. Kennst du nicht das Zitat von Hermann Hesse? Und jedem Anfang…“ „…wohnt ein Zauber inne“, vollendete Liz den Satz. „Im Augenblick kann ich nur leider den Zauber noch nicht erkennen“, seufzte sie und lehnte sich in dem bequemen Gartenstuhl zurück. „Wir besuchen morgen meine Freundin Gerti in Langenburg“, verkündete Liz‘ Großmutter. „Von dort aus können wir das Jagsttal erkunden. Denn dort liegt deine zukünftige Schule.“ „Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich wirklich dorthin gehe“, wandte Liz ein. „Warten wir’s ab“, meinte Oma Doro und lächelte ihrer Enkeltochter aufmunternd zu.
„Weißt du was? Wir machen noch einen Stadtbummel. Was hältst du davon?“ Liz zuckte mit den Schultern. „Ja, warum nicht?“ So schlenderten Großmutter und Enkeltochter alsbald fröhlich schwatzend durch die Straßen, überquerten eine der Brücken über den Neckar und kamen zum Heilbronner Marktplatz. Liz blieb stehen und schaute zum Turm der Kilianskirche hinauf. Sie liebte alte Gemäuer, und diese Kirche war wirklich sehr alt. Der im Renaissancestil erbaute Westturm war nicht unbedingt das, was ihr jedes Mal ins Auge stach, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Wurzeln dieser Kirche bis ins 8. Jahrhundert zurückreichten. Als sie über den Marktplatz zum Rathaus schlenderten, fühlte sich Liz plötzlich unwohl. Sie hatte das Gefühl, als würden sie verfolgt, und hastig drehte sie sich um. „Was ist nur los mit dir, Liz?“, wunderte sich die Großmutter über die hektisch werdenden Schritte ihrer Enkelin. „Ich weiß nicht, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich glaube, auf diesem Platz ist zu viel Geschichte“, mutmaßte sie. Oma Doro lachte auf. „Ja, das kannst du laut sagen. Schau mal da drüben, da ist eine historische Stadtführung. Davor gibt es hier viele.“ Liz blickte zu der Gruppe Menschen, die sich um einen Stadtführer in mittelalterlicher Gewandung scharten. Neugierig geworden, ging Liz betont langsam an der Gruppe vorbei, um den ein oder anderen Satz aufzuschnappen. „…das waren ganz bewusst öffentliche Hinrichtungen. Es sollte ja zur Abschreckung dienen…“, hörte Liz, und „…Scheiterhaufen, vielleicht direkt hier…“ Eine Welle der Übelkeit überrollte sie, und sie musste sich rasch abwenden und sich von der Gruppe entfernen. „Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen hier verurteilt wurden und auf dem Platz öffentlich hingerichtet oder bestraft wurden“, raunte ihr die Großmutter zu. Liz spürte, wie ihr ein Schauer über den Rücken jagte. Gänsehaut pur. Nein, sie wollte hier weg. Kaum hatten sie den Marktplatz überquert, war alles wieder gut, und Liz hatte das beklemmende Gefühl rasch wieder vergessen.
Als sie abends auf ihr Handy schaute, erschrak sie. Sieben Anrufe in Abwesenheit: Marcel. Sie hatte ganz vergessen, ihm zu schreiben, dass sie nach Heilbronn gefahren war. Zum Glück war er ihr nicht böse, sondern eher erleichtert, dass ihr nichts zugestoßen war. In wenigen Sätzen erzählte Liz ihrem Freund den Stand der Dinge. „Du willst aber jetzt nicht ernsthaft nach Hohenlohe, Liz?“, fragte er entsetzt. „Nein, ich habe noch nichts entschieden“, beschwichtigte sie ihn. „Aber ich möchte es mir auf alle Fälle mal anschauen“, setzte sie nach. „Weißt du, dass das gefühlt am Ende der Welt ist? Da ist der Hund begraben. Ich habe gehört, die Menschen dort sprechen einen ganz eigenartigen Dialekt, den keiner verstehen kann, der nicht selbst dort geboren ist. Da gibt es Dörfer, in denen leben mehr Schafe oder Kühe als Menschen. Liz, wir wollten zusammenziehen. Wie stellst du dir das denn vor?“ „Du kannst ja mitkommen“, platzte es aus Liz heraus. Sie wusste, dass sie ihren Freund damit provozierte. Aber ihr gefiel es nicht, dass er so vorschnell urteilte, obwohl er die Gegend noch gar nicht kannte. „Bist du wahnsinnig? Du weißt, dass mein Job hier ein Sechser im Lotto ist.“ Marcels Reaktion überraschte sie nicht. „Jedenfalls, morgen fahren Oma Doro und ich nach Langenburg, und von dort aus erkunden wir das Jagsttal und schauen uns auch mal dieses Mulfingen an. Ich kann doch kein Urteil über etwas fällen, was ich nicht kenne.“ „Dir ist schon klar, was das für unsere Beziehung bedeuten würde?“, fragte Marcel. „Nein?“, sagte Liz fragend. „Eine Wochenend-Beziehung ist eigentlich nicht das, was ich mir auf lange Sicht vorgestellt habe…“, beantwortete sich Marcel die Frage selbst. Er klang verbittert und enttäuscht. Liz wusste nicht, was sie darauf noch sagen sollte, denn um ehrlich zu sein, hatte sie nicht damit gerechnet, dass ihr Freund nun gleich ihre ganze Beziehung infrage stellen würde. Immerhin waren sie seit fast drei Jahren zusammen. „Marcel, ich glaube, Oma hat mich zum Essen gerufen. Wir schreiben morgen wieder, ja?“, flunkerte sie und legte traurig auf. Da war so wenig von ihrer Liebe zu spüren gewesen. Zum ersten Mal, seit sie mit ihm zusammen war, überlegte sie, ob sie sich wirklich so nahestanden, wie sie immer gedacht hatte.
Als Liz an diesem Abend in ihrem Bett lag, fand sie lange nicht in den Schlaf. Unruhig wälzte sie sich von einer Seite auf die andere, bevor sie in einen unruhigen Traum fiel.
Ich hatte keine großen Erwartungen an meinen Herrn, denn ich war an ein Leben in Armut gewöhnt. Angeboten hatten sie mich, als wäre ich eine Kuh, die auf dem Markt verkauft wird. Meine Eltern hatten es so entschieden, und ich konnte es ihnen nicht einmal verübeln. Ich war das siebte von elf Kindern. Meine Mutter war mit dem zwölften schwanger. Schon die Geburt meines kleinen Bruders hatte sie so mitgenommen, dass die Hebamme befürchtet hatte, sie würde es nicht überleben. An diese Nacht wollte ich nicht zurückdenken, und doch kamen die Erinnerungen immer wieder. Meine Aufgabe war es damals, der Hebamme heißes Wasser zu bringen und das blutig verschmutzte Wasser im Hof auszuschütten. Das Wasser musste ich vom Brunnen im Hof holen und in der Küche über dem Holzfeuer erhitzen. Den Topf mit dem heißen Wasser brachte ich in das Zimmer, zu dem sonst niemand Zutritt hatte, und in dem meine Mutter sich vor Schmerzen wand und krümmte. Das Baby war längst da, doch die Wehen hörten und hörten nicht auf. Noch schlimmer war, dass die Tücher, mit denen die Hebamme das dunkelrote Blut aufsaugte, nicht weniger wurden, sondern mehr. Zuerst hatte die Hebamme nichts gesagt, doch dass etwas nicht in Ordnung war, das spürte ich. Außerdem wurden die Schweißperlen auf der Stirn der erfahrenen, kräftigen Frau immer mehr. Und mein Vater wurde immer unruhiger, die Schritte, mit denen er in der Stube auf und abging, wurden immer heftiger und verzweifelter. Sein Blick, wenn ich denn einen Blick erhaschte beim Hin- und Hertragen des Wassers, wurde immer hilfloser und leerer, als würde er in Gedanken schon durchspielen, wie er sich als Witwer mit elf Kindern durchschlagen konnte. „Die Nachgeburt löst sich nicht“, murmelte die Hebamme vor sich hin, „wenn sie nicht kommt, verblutet sie.“ Aber die langjährige Erfahrung der Frau und ein Trank, welchen sie aus unzähligen Kräutern gebraut hatte und in einer kleinen Glasflasche aus ihrem ledernen Koffer holte, brachten die entscheidende Wendung. Die Presswehen setzten ein letztes Mal ein, und mit einem kraftlosen Schrei gelang es meiner Mutter, einen unförmigen, dunkelroten Fleischfetzen aus ihrem Körper zu befördern. Die Blutungen ließen nach, ein letztes Mal das Wasser auswechseln, meiner Mutter ein stärkendes Bier bringen, den schreienden Säugling, um den sich keiner gekümmert hatte, waschen und gebündelt der entkräfteten Wöchnerin an die Brust legen … So war das gewesen. Elf Kinder waren schon zu viel gewesen. Zwölf ging nicht mehr. Der kleine Hof meiner Eltern konnte längst nicht mehr alle Kinder ernähren. Meine Brüder arbeiteten auf dem Feld, doch die Ernten der letzten Jahre waren einer anhaltenden Dürre zum Opfer gefallen. Einen Teil galt es dennoch abzugeben, denn der Hof war nur zu Lehen, und es galt jedes Jahr den Zehnten abzugeben. Wovon aber den Zehnten abgeben, wenn die eigenen Mäuler nicht gestopft werden konnten? Zudem wurde ich älter. Ich hatte bereits die erste Monatsblutung gehabt; es war an der Zeit, dass ich unter die Haube kam oder in eine Anstellung. Da ich keine Mitgift hatte, mussten meine Eltern froh sein, als ihnen für mich Geld geboten wurde. Ich sollte Hausmagd beim Medicus Braunert in Heilsbronn werden. Schwere Arbeit war ich gewohnt. Auf dem Hof meiner Eltern hatte ich ein Bett mit zwei Geschwistern geteilt. In der Kammer standen drei Betten. Die jüngsten Geschwister schliefen im Zimmer der Eltern. Als mir die Gattin des Arztes, meine Herrin, eine Kammer unter dem Dach ganz für mich allein zuwies, fühlte ich mich wie eine Königin. Eine Bettstelle mit einem Strohsack und einer Decke aus Daunen ganz für mich allein? Genug zu essen, auch wenn es oftmals nur die Reste waren, welche die Herrschaften nicht aufgegessen hatten? Ich kam mir vor, als wäre ich im Himmel. Die Arbeit, die ich täglich zu verrichten hatte, war nicht unmenschlich. Meine Aufgaben bestanden darin, vor den Herrschaften aufzustehen und das Feuer im Kamin und im Herd anzuzünden, Holz ins Haus zu holen, der Köchin in der Küche zur Hand zu gehen, Botengänge zu erledigen, auf dem Markt einzukaufen, die Böden zu schrubben, Teppiche zu klopfen, Betten aufzuschütteln, die Wäsche im Waschhaus zu waschen.
Bei meinen Eltern hatte ich im Stall gearbeitet und Wasser geholt, ich hatte die Wäsche zum Bach getragen und dort mit Seife geschrubbt, um sie anschließend zuhause im heißen Wasser auszuwaschen. Die Arbeit war viel schwerer gewesen. Der Medicus Braunert war ein angesehener Mann in der Stadt, und deswegen wohnte er in einem großen, herrschaftlichen Haus mit zwei Stockwerken. Im unteren Geschoss befand sich das Behandlungszimmer und seine Apotheke. Er verstand sich auf vortreffliche Weise vor allem darauf, Menschen mit langwierigem Husten und Schmerzen an den Gelenken zu helfen. So kamen die Kranken aus nah und fern zu ihm. An Arbeit mangelte es ihm nicht. Seine Gattin führte das Regiment über den Haushalt, besprach sich mit der Köchin, beschäftigte sich mit Handarbeiten und veranstaltete Essen mit anderen wichtigen Herrschaften der Stadt. Für meine Begriffe hatte sie ein einfaches Leben. Doch sie erschien mir nicht glücklich dabei zu sein. Das konnte ich an ihren Gesichtszügen erkennen. Zwischen den Augen hatten sich schon strenge Falten gebildet, obgleich sie noch nicht wirklich alt war, und ihr Mund sah ganz verkniffen aus; lächeln sah ich meine Herrin nie. Vielleicht war ihr Leben schwerer, als ich es mich vorstellen konnte. Ich war ja auch nur eine einfache Magd, ich konnte weder lesen noch schreiben, und zudem war ich völlig mittellos. Natürlich machte ich mir Gedanken. Warum, so fragte ich mich, hatte meine Mutter zwölf Kinder, die Frau des Medicus Braunert aber kein einziges? Meine Mutter hatte jeden Tag schwer gearbeitet, aber dennoch hatte ich gespürt, dass zwischen meinen Eltern so etwas wie Nähe oder Wärme war. Wenn der Medicus Braunert seine Sprechstunden beendet hatte, saßen die Eheleute schweigend zu Tische. Ich glaube, das war für mich am schwierigsten auszuhalten, diese Stille, obwohl Menschen anwesend waren. Zuhause durfte man bei Tisch selbstverständlich auch nicht sprechen. Sprechen durfte nur der Vater, und zwar das Tischgebet. Danach war jeder damit beschäftigt, sich auf das wenige Essen zu konzentrieren, das es gab. Dennoch hatte es sich mehr nach Leben angefühlt als im Haus des Medicus. Der heilte andere Menschen, doch seine eigene Frau erschien mir kränker zu sein als alle, die den Medicus Braunert je aufgesucht hatten.
Ich kann nicht sagen, wie lange ich im Hause des Arztes diente, als er begann, mir diese Blicke zuzuwerfen. Die Blicke konnte ich anfangs nur spüren. Ich nahm sie wahr, wenn ich mich von ihm wegdrehte, um abzutragen. Sie bohrten sich in meinen Rücken und breiteten sich wie heiße Wellen von dort aus. Wenn ich ihm begegnete, senkte ich meinen Blick. So hatten sie mir das beigebracht, dass man den Herrschaften nicht in die Augen zu blicken hatte. Doch er schaffte es, seinen Blick auf eine solch ungehörige Weise von unten her Richtung meinem zu wenden, dass ich nicht länger imstande war, ihm auszuweichen. Noch nie hatte ich solche Augen gesehen. Sie waren von stechend hellem, klarem Blau, und ich hatte das Gefühl, ich würde in diesen Augen versinken. Zittern ließen sie mich, beben, am ganzen Körper, und ich wusste nichts damit anzufangen, konnte es nicht einordnen und begreifen, was da vor sich ging. Ich spürte nur, dass es mir nicht unangenehm war, wenn er mich so anschaute. „Dein Name ist Magdalena, nicht wahr?“ Als er mich eines Tages ansprach, schreckte ich zusammen. Er hatte eine tiefe, angenehme Stimme. Zum ersten Mal hob ich meinen Blick und sah ihn an, während ich nickte. „Kannst du auch sprechen? Ich habe noch nie deine Stimme gehört“, sagte er leise. Fragend schaute ich ihn an. Was wollte er von mir? „Kannst du?“, wiederholte er sich. Wieder nickte ich und senkte meinen Blick. Er machte mich verlegen, wie er da vor mir stand. Ich hatte den Arm voller gestärkter und gebügelter Tischtücher und war auf dem Weg, sie in den großen Wäscheschrank in der Diele zu bringen. Als ich versuchte, mich an ihm vorbeizudrücken, stellte er sich mir in den Weg. „Magdalena?“, fragte er mich erneut. Was wollte er von mir. Hatte ich einen Fehler gemacht? Doch in seiner Stimme lag kein strafender Ton, es ging keinerlei Bedrohung von ihr aus. Vielmehr schien er neugierig zu sein. „Mein Herr, ich habe den Auftrag Ihrer Gattin, die Tischwäsche in den Dielenschrank zu bringen“, sagte ich leise. Ich erschrak ein wenig, meine eigene Stimme zuhören, denn ich war es nicht gewohnt, sprechen zu dürfen in diesem großen Haus. Lediglich mit der gutherzigen, dicken Köchin Friedlinde plauderte ich ausgelassen, wenn wir in der Küche gemeinsam zugange waren. „Du kannst ja doch sprechen“, sagte der Herr Medicus, lächelte zufrieden und tat wieder einen Schritt zur Seite, um mich daran zu hindern, mit der Wäsche an ihm vorbeizuhuschen. „Weshalb sollte ich nicht sprechen können? Hättet Ihr eine stumme Magd eingestellt?“, hörte ich mich sagen und verstummte augenblicklich, schämte ich mich doch für meine freche Antwort. Doch dem Medicus schien das zu gefallen. Das sagte er nämlich. „Du gefällst mir“, vernahm ich seine Stimme. Als er das sagte, spürte ich, wie mir die Röte ins Gesicht schoss und die Wangen glühen ließ. „Bitte, lasst mich meine Arbeit tun“, murmelte ich. Da trat er zur Seite. „Du gefällst mir, Magdalena!“ Weshalb sagte er das? Und wie konnten so wenige Worte so viel in mir aufwühlen? Ich drückte die Wäsche an meine Brust und eilte den Gang entlang.
Völlig neben mir kam ich mir vor. Das merkte auch Friedlinde, als ich in die Küche zurückkam. „Was ist los, Magdalena?“, fragte sie mich. Ich setzte mich, schüttelte den Kopf, atmete tief durch und hielt meine Hände gegen die glühenden Wangen. „Der Herr…“, stammelte ich, „der Herr…“. Mehr konnte ich nicht sagen. „Hat er dich unsittlich berührt?“, fragte Friedlinde aufgebracht. Ich schüttelte heftig den Kopf. „Nein, wo denkst du hin!“, rief ich empört. „Dann ist es ja gut.“, meinte die dicke Köchin nur, strich mir über den Kopf und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. „Das Getreide muss gemahlen werden, wir wollen Brot backen“, trug sie mir auf. Gehorsam machte ich mich an die Arbeit, die sie mir angetragen hatte. „Bleib auf der Hut, hörst du?“, sagte sie noch zu mir. „Du wärst nicht die erste Magd, die…“ Sie sagte es leise. Und sie sprach den Satz nicht zu Ende. Aber ich merkte, dass er nichts Gutes bedeutete.
2. Kapitel
Noch erreiche ich sie nicht. Durcheinander ist sie, gefangen in ihren eigenen Sorgen und Nöten. Doch eines Tages, eines nachts, da wird sie zuhören und verstehen …
Liz mochte Gerti auf Anhieb. Sie war eine drahtige ältere Dame mit flottem Kurzhaarschnitt, die zu ihren grauen Haaren stand und nicht krampfhaft auf jugendlich machte, aber dennoch ein flottes Auftreten hatte. Offensichtlich hatte Oma Doro sie schon vorbereitet, denn sie begrüßte Liz mit den Worten: „So, du bist also Liz, die Hohenlohe kennenlernen möchte?“ Liz nickte und erwiderte den kräftigen Händedruck. „Dann fangen wir mal hier mit Langenburg an, einer kleinen Perle hier im Jagsttal, wie ich finde.“ Die beiden Freundinnen hatten sich viel zu erzählen und plauderten angeregt, während sie das Langenburger Schloss umrundeten. Schon bald schien es, als hätten sie Liz vergessen, was sie nicht weiter schlimm fand.
Sie hatte nicht besonders gut geschlafen in der vergangenen Nacht. Wirres Zeug hatte sie geträumt. Sie konnte es nicht wirklich einordnen, sich nicht mehr an Einzelheiten erinnern, und sie fühlte sich wie gerädert. Deswegen war sie froh, nicht den ganzen Tag Konversation betreiben zu müssen. Stattdessen erkundete Liz den kleinen Ort auf ihre Weise. Sie liebte es, zu fotografieren. Ihre Digitalkamera hatte sie immer dabei, und sie fing Stimmungen und Bilder ein, auf die andere im Vorübergehen gar nicht achten würden. „Du hättest Fotografin werden sollen“, hatte neulich Johan aus der WG zu ihr gesagt, als sie ihre jüngsten Schnappschüsse ausgelegt hatte. „Damit den Lebensunterhalt zu verdienen, ist eine Kunst für sich“, hatte sie nur zu ihm gesagt. Fotografieren sollte ihr Hobby bleiben, das stand fest. Die Schlossanlage zog Liz sofort in ihren Bann. Schon immer hatte sie ein Faible für alte Gemäuer gehabt. Sie entdeckte den einen und den anderen Winkel, betrachtete die Steine und wie sie behauen worden waren oder bewunderte die kleinen Blumen, die sich aus den Mauerritzen drängten und eifrig blühten.
Als sie sich nach dem Rundgang im Schlosscafé trafen, verschlug es Liz fast den Atem beim Ausblick auf das Tal, das sich entlang des Flüsschens schlängelte. Weit und breit war nichts zu sehen als grüne Wiesen und Wälder an den Hängen. Kein Lärm drang zu ihnen herauf, keine Häuser versperrten den Blick, keine Fabriken, keine rauchenden Schornsteine, es waren keine Blechlawinen zu sehen, die sich durch Straßen quälten. Es war einfach atemberaubend schön. Und es war grün von einer satten Pracht, wie sie es noch nirgends zuvor wahrgenommen hatte. Aus den Augenwinkeln beobachtete Liz, wie Gerti ihrer Großmutter kichernd mit dem Ellbogen in die Seite stieß. „Eins zu null für das Jagsttal, würde ich sagen“, meinte Oma Doro und setzte ein spitzbübisches Grinsen auf. Liz lächelte und nickte. „Ja, es ist wirklich unwahrscheinlich schön hier. Aber ob ich hier leben könnte? Ich weiß nicht. Es ist wirklich GAR nichts los hier.“ „Los, los, los…“, echote die Großmutter, „was soll denn immer los sein? Ihr jungen Leute müsst immer was loshaben. Du solltest eher endlich mal zur Ruhe kommen, liebe Liz. Du machst auf mich ohnehin den Eindruck, als seist du immer nur auf der Flucht.“
Liz schwieg. Das saß. Sie wusste, was ihre Oma damit meinte. Und sie hatte sogar recht. Liz` größtes Problem war ihre permanente Unruhe. Sie war kaum beim einen angekommen, da musste sie schon das nächste planen. Für sie war es unglaublich schwer, sich einfach fallen zu lassen und im Hier und Jetzt zu verweilen. Natürlich fiel das in einer großen, hektischen Stadt, die per se schon unruhig war, deutlich weniger auf als hier in dieser ländlich ruhigen Langsamkeit.
Zunächst einmal ließ sie sich aber tatsächlich auf das Schlosscafé ein und genoss einen unglaublich leckeren Eisbecher. Und als sie sich anschließend auf den Weg Richtung Mulfingen machten, verspürte Liz zumindest ansatzweise so etwas wie Neugierde. Sie musste die Stelle nicht annehmen, wenn es ihr nicht gefiel, sagte sie sich. Außerdem musste sie sich heute noch nicht entscheiden, dachte sie. Einfach nur mal schauen. Die schmale Straße ließ ein flottes Fahren nicht zu, denn man konnte überhaupt nicht sehen, was nach der nächsten Kurve kam. Liz trommelte ungeduldig mit den Fingern auf ihrem Lenkrad herum, als auch noch eine Horde Fahrradfahrer vor ihr auf der schmalen Straße aufkreuzte. An ein Überholen war nicht zu denken, denn immer wieder kam Gegenverkehr. „Hast du es denn eilig, Elisabeth?“, fragte Oma Doro und legte ihre Hand beschwichtigend auf Liz‘ Unterarm. Liz seufzte: „Nein, natürlich nicht. Warum sind denn hier überhaupt so viele Fahrradfahrer?“ „Vielleicht weil es ihnen hier gut gefällt? Schau mal, links von dir, die Jagst. Ist das nicht idyllisch?“ Liz blickte kurz in die angezeigte Richtung, konzentrierte sich dann aber sofort wieder auf die kurvenreiche Straße. Ihre Großmutter hatte recht. Es war eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Aber wo blieben denn um Himmels Willen größere Ortschaften? Seit bestimmt 15 Minuten fuhren sie nun schon im Spazierfahrt-Tempo durch die schöne Landschaft. Das Flüsschen schlängelte sich glitzernd nur wenige Meter von der Straße entfernt durch das Tal. „Wir müssten bald in Mulfingen sein“, sagte Oma Doro lächelnd.
Und dann passierten sie das Ortsschild. Liz‘ Herz machte einen nervösen Hüpfer. Ungeduldig versuchte sie, rechts und links der Straße Blicke zu erhaschen, die ersten Häuser und Gärten. „Liebes, bitte schau auf die Straße“, mahnte die Großmutter, und Liz zwang sich, wieder konzentrierter zu fahren. „Da vorn musst du rechts abbiegen“, rief sie, und aufgeregt setzte Liz den Blinker. Ihr Herz begann im schnellen Takt des Blinkers zu pochen, und zugleich ärgerte sie sich darüber, dass sie so hibbelig war. Hier, JWD, was sollte hier schon passieren, was einen aufgeregt sein ließ? Hier wollte sie doch nicht wirklich ihre erste Stelle antreten? Sie überlegte, was Marcel jetzt wohl sagen würde, wäre er dabei. Doch er war nicht dabei. Vielleicht war das gut so, dachte Liz. Sie wusste, dass es ihm nicht gefallen würde und dass er ihr das auch ganz schnell und unmissverständlich deutlich machen würde. Mit Oma Doro konnte sich Liz eine eigene Meinung bilden.
Die moderne Schule schmiegte sich harmonisch in das Tal. Sie war neu erbaut, mit Holz verkleidet, und sie war von einem großzügigen Pausenhof umgeben. Sportplätze schlossen sich an, ein weiteres Gebäude, das offenbar als Mensa diente, gab es auch, und auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren weitere große Gebäude, die auch wie eine Schule aussahen, aber nicht zur Grundschule gehörten. „Das sind die Sporthallen und die weiterführende Schule“, wusste Oma Doro, die sich vorher im Internet schlau gemacht hatte. Gerti war mit ihrem eigenen Auto vorausgefahren. Als sie ausstieg, machte sie eine ausladende Bewegung mit den Armen. „Ist das nicht wunderschön hier? Ein modernes Gebäude, erst vor wenigen Jahren eingeweiht.“ In der Tat war Liz beeindruckt. Die Schule strahlte etwas Warmes und Einladendes aus, und zu gern wäre sie einfach direkt hineinspaziert. Aber es waren Ferien, und die Schule war geschlossen. „Na, habe ich dir zu viel versprochen?“, wollte Gerti wissen. Liz schüttelte den Kopf. „Die Schule sieht sehr schön aus. Was ist mit dem Rest der Stadt?“, fragte sie. Gerti lachte leise auf. „Welche Stadt? Mulfingen ist keine Stadt. Es ist im Grunde ein großes Dorf mit vielen kleinen Gemeinden im Umkreis, die noch mit dazu gehören.“ „Oh!“, entfuhr es Liz. Dabei wusste sie selbst nicht so recht, ob sie damit Enttäuschung oder Überraschung zum Ausdruck bringen wollte. Auf jeden Fall machte sie mit dem Smartphone zwei, drei Bilder. Sie wollte Marcel die Schule zeigen. ‚Das wäre die Schule in Mulfingen‘, tippte sie flink ein und drückte auf ‚Senden‘. „Puh, eine richtig gute Verbindung hat man hier aber nicht“, beschwerte sie sich. „Ja, nicht wahr, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, da braucht es kein Internet.“, spöttelte Oma Doro. „Mensch, Omi!“, sagte Liz mit einem vorwurfsvollen Blick. „Ich wollte nur Marcel die Schule zeigen. Weil sie mir sogar gefällt“, setzte sie nach. Kaum war ihre Nachricht gesendet, brummte ihr Handy. Das war aber schnell gegangen mit der Antwort. ‚Sieht ja richtig schick aus‘, schrieb Marcel. Das freute Liz. Immerhin war die erste Reaktion ihres Freundes nicht gleich negativ.
„Bist du Lehrerin?“ Liz fuhr herum. Ein Mädchen von vielleicht sieben oder acht Jahren war mit ihrem Fahrrad neben sie gefahren und schaute sie durch ihre runde Brille neugierig an. Liz musste lächeln und nickte. „Und du, bis du Schülerin?“, fragte sie zurück. Das Mädchen nickte wichtig. „Das hier ist meine Schule!“, erklärte es stolz. „Und, gefällt es dir in der Schule?“, wollte Liz wissen. „Ja klar, aber jetzt sind Ferien. Nach den Ferien komme ich schon in die dritte Klasse.“ Also war das Mädchen vermutlich acht, schlussfolgerte Liz. „Dann kannst du ja schon richtig lesen und schreiben“, sagte sie anerkennend. „Ja, wir haben vor den Sommerferien sogar den Füller-Führerschein gemacht. Ich liebe es, Schreibschrift zu schreiben“, schwärmte die Kleine. Liz lachte leise. „Liebst du auch, Schreibschrift zu schreiben?“, wollte das Mädchen wissen. Liz wiegte nachdenklich den Kopf hin und her. „Hm, naja, was heißt lieben … ich schreibe schon gern, aber ich glaube, ich lese lieber. Liest du denn auch gern?“ Das Mädchen nickte und strahlte. „Ich lese am liebsten Sternenschweif-Bücher.“ „Ah, die kenne ich. Da bist du bestimmt eine richtig gute Schülerin, was?“ Das Mädchen zuckte mit den Schultern. „Naja, Mathe mag ich nicht so. Plus geht, aber Minus finde ich echt schwierig.“ „Und Einmaleins?“, hakte Liz nach. „Das kann ich gut“, strahlte das Mädchen stolz. Oma Doro und Gerti hatten inzwischen eine Runde um das Schulgebäude gedreht. „Wo bist du Lehrerin?“, fragte die kleine Madame Naseweis. Liz lachte und überlegte, was sie antworten sollte. „Im Augenblick noch nirgends“, sagte sie dann. „Du kannst ja an meine Schule kommen“, sagte das Mädchen großzügig. „Tschühüß!“ Und damit radelte es wieder davon. Liz blickte ihm unauffällig nach und überlegte, ob das Mädchen wohl in ihre Klasse käme, wenn sie diese Stelle hier annehmen würde. Außerdem, das fiel ihr jetzt auf, hatte sie überhaupt keine Probleme gehabt, die Kleine zu verstehen. Vielleicht war der Dialekt doch nicht so kompliziert, wie sie gedacht hatte?
„Na, habt ihr euch gut unterhalten?“, wollte die Großmutter wissen. Liz lachte. „Ja, die Kleine meinte, ich könne sehr gern an ihre Schule kommen.“ „Na dann, worauf wartest du?“ Sie umrundete die Schule nun auch selbst. In die Zimmer im Erdgeschoss konnte man von außen gut schauen. „Meine Schule in Karlsruhe war richtig altmodisch im Vergleich zu der hier“, meinte sie. „Komplett veraltet, zusammengewürfeltes Mobiliar, düster. Da halfen auch die bunten Vorhänge und die Tierposter an den Wänden nicht viel“, erzählte sie. „Wichtig ist ja, wie man in den Räumen lebt und lernt“, meinte Gerti, „oder liege ich da ganz falsch?“ Liz zuckte mit den Schultern. „Natürlich kann man aus allem immer was Positives machen. Aber ich muss sagen, so eine schöne, freundliche, helle und einladende Schule habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen.“ Sie war ehrlich beeindruckt. „Schade, dass sie nicht in Karlsruhe ist“, meinte sie dann. „Aber was nützte es dir, wäre sie in Karlsruhe?“, gab Oma Doro zu bedenken. „Du bist nach Hohenlohe versetzt.“ Wo sie recht hatte, hatte sie recht.
Gerti wollte sich wieder auf den Heimweg nach Langenburg machen, schlug Liz und ihrer Großmutter aber vor, noch einen kleinen Schlenker zu fahren, um ein wenig von der Landschaft zu sehen. Als sie fast schon aus dem Dorf Mulfingen herauskamen, stach Liz die Ortschaft auf dem Berg ins Auge. Man konnte schon aus der Ferne Fachwerkhäuser und einen Kirchturm erblicken, die sich malerisch auf die Bergkuppe gesetzt hatten. „Können wir da mal hochfahren?“, bat sie und hatte schon den Blinker gesetzt. Die Straße führte in einigen Schleifen den Berg hinauf. Als sie das Ortsschild passierten, lief Liz ein Schauer über den Rücken, ohne einordnen zu können, ob er wohlig oder unangenehm war. Sie musste sich unweigerlich schütteln. „Was war denn das?“, fragte Oma Doro verwundert. „Keine Ahnung, das überkam mich einfach so“, gab Liz ebenso verwundert zurück. ‚Jagstberg‘, las sie auf dem Ortsschild. „Ob es hier mal eine Burg gab?“ „Bestimmt, bei dieser Lage so auf dem Berg oberhalb des Jagsttals liegt das ja nahe“, mutmaßte auch Liz‘ Großmutter. Viel zu kurz dauerte die Fahrt durch das kleine Dörfchen mit seinen schmucken Häuschen, da waren sie auch schon auf der breiten Landstraße.
Den Verkehrsschildern nach zu urteilen, befanden sie sich jetzt wieder auf der Straße Richtung Künzelsau, und von dort aus würde es sie weiter nach Heilbronn führen. „Du, Oma“, sagte Liz nach einiger Zeit, die sie schweigend im Auto gesessen hatten. Die Großmutter blickte sie von der Seite an. „Sollte ich mich tatsächlich entscheiden, die Stelle anzunehmen, ich glaube, ich würde am liebsten in Jagstberg wohnen.“ „Na, dann kannst du dich ja schon mal auf Wohnungssuche begeben“, meinte Oma Doro und lachte. Je weiter sie sich vom Jagsttal entfernten, desto nachdenklicher wurde Liz. Die Großmutter spürte, dass ihre Enkelin jetzt nicht zu langen Gesprächen aufgelegt war, und so fuhren die beiden schweigend dahin, wippten mit den Füßen oder klopften mit den Fingern zum Takt der Musik aus dem Radio.
Liz fühlte sich gut. Sie war ihrer Großmutter dankbar, dass sie darauf bestanden hatte, sich dieses Mulfingen im Jagsttal und die Schule anzuschauen. Vor allem aber hatte sie das Gefühl, als sei es wichtig gewesen, das kleine Dorf auf dem Berg zu entdecken. Am liebsten hätte sie dort angehalten. Aber was hätten sie dann tun sollen? Das war kein Ort, an dem Touristen Halt machten, das konnte man sehen. Es hatte geschäftiges Treiben geherrscht, wie es in kleinen, ländlichen und noch bäuerlich geprägten Dörfern oft der Fall war. Sie hätte sich unwohl gefühlt, wie auf dem Präsentierteller, und so etwas mochte Liz nicht. Ihr erster Gedanke, als sie wieder im Haus der Großmutter war, galt ihrem Freund, und sie suchte in ihrer Handtasche nach dem Handy, um Marcel zu schreiben. Doch er war ihr schon zuvorgekommen: ‚Bist du jetzt geheilt vom Jagsttal? Wann kommst du zurück nach Hause?‘ Die WhatsApp ihres Freundes peitschte ihr regelrecht ins Gesicht. Zitternd setzte sie sich auf ihr Bett. Was meinte er mit ‚geheilt‘? Und warum konnte sie es nicht so empfinden, dieses ‚nach Hause?‘ Plötzlich hatte sie das Gefühl, als wisse sie gar nicht mehr, wo sie eigentlich hingehörte. Vor allem aber spürte sie, dass Marcel aus irgendeinem Grund emotional sehr weit weg von ihr war. Es wurde ein nachdenklicher Abend und eine unruhige Nacht.
Meinem Herrn auszuweichen, war an sich keine Schwierigkeit in dem großen Haus. Das Problem lag eher darin, dass ich ihm gar nicht wirklich ausweichen wollte. Ich ahnte, dass die Köchin recht hatte mit ihrer Warnung. Aber ich wusste nicht, wovor sie mich genau warnte. Vermutlich hatte es etwas mit dem Berühren zu tun, und das hatte der Herr ja nicht getan. Das tat er auch in den folgenden Tagen und Wochen nicht. Er berührte mich nicht mit seinen Händen, nein. Aber er berührte mich mit seinen Blicken. Wenn wir uns begegneten, dann waren es immer nur kurze Augenblicke, flüchtige Momente, doch sie genügten, um in mir ein Gefühl zu wecken, das ich so noch nie verspürt hatte. Später wusste ich, dass man es Sehnsucht nennt. Es war nicht zu vergleichen mit dem Wunsch nach körperlicher Nähe zu meiner Mutter, die ich immer schon mit den vielen Geschwistern hatte teilen müssen und die deswegen kostbar und rar gewesen war.
Wenn wir uns begegneten in dem großen Haus mit den dunklen Fluren, blieben wir stehen, und ich spürte seinen Blick, der so lange in mich bohrte, bis ich den Kopf hob und ihm in die Augen sah. Und dann begann zwischen uns etwas sehr Warmes zu fließen, als wären wir durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden. ‚Magdalena‘ …. Allein die Art, wie er nur meinen Namen sagte, ließ mich innerlich erzittern. Mehr sprachen wir nicht. Anfangs war es nur das zwischen uns; wir standen wortlos da und schauten uns in die Augen. Und genau danach begann ich mich zu sehnen. Deswegen suchte ich mehr und mehr Möglichkeiten, meinem Herrn zu begegnen. Ich durfte es mir nicht anmerken lassen, und so versuchte ich, eher zufällig genau in dem Moment mit der Wäsche ins Waschhaus zu gehen, in dem er seinen Behandlungsraum verließ. Es sollte kein anderer sehen, wie wir uns mit unseren Blicken begrüßten. So vergingen viele Wochen, und wenn es einen Tag gegeben hatte, an dem wir uns nicht begegnet waren, so lag ich des nachts lange wach. Ich stellte mir vor, wir würden uns begegnen und würden uns ansehen, und es gelang mir, dieses Gefühl in mir hervorzurufen und ihm nachzuspüren, dieses Ziehen und Brennen und Kribbeln, das durch den ganzen Körper fuhr und mich erröten ließ.
Je länger das so ging, desto mehr wurde mir bewusst, dass das nicht rechtens war, was wir da taten, denn er war mein Herr und er hatte eine Ehefrau. Diese wiederum wirkte von Tag zu Tag noch betrübter, verbitterter und trauriger. Einmal wagte ich, die Köchin zu fragen, weshalb die Herrin so verbittert sei. Friedlinde zuckte nur die Schultern und seufzte. Dann blickte sie von ihrem Wurzelgemüse auf, welches sie gerade schabte, und dachte nach. Ich vermutete, dass sie überlegte, mit welchen Worten sie mir den Sachverhalt erklären sollte. „Weißt du, Magdalena, ich vermute das nur. Die Herrin und der Herr wünschen sich schon lange ein Kind. Doch es scheint nicht Gottes Wille zu sein. Sie hatten sogar schon Ärzte da, die sich besonders gut auf diese Geschichten verstehen und offenbar anderen Eheleuten schon hatten helfen können, doch vergeblich.“ Ich hatte schon so etwas vermutet. Das sagte ich ihr auch. „Weißt du, Friedlinde, vielleicht mag da kein Kind in ihr sein, wenn sie immer so böse schaut.“ Die alte Köchin musste herzlich lachen. „Ach, du dummes Ding“, rief sie. „weißt du denn nicht, dass ein Mann bei einer Frau liegen muss, damit ein Kind in ihren Bauch gepflanzt wird?“ Das war nicht nett von ihr, mich auszulachen, und ich schämte mich für meine Worte. „Doch, das weiß ich wohl“, empörte ich mich, wenngleich es nicht die Wahrheit war. Die Wahrheit war, dass ich gar nichts wusste. Ich wusste nur, dass ich, seit ich meinen Blutfluss hatte, auch ein Kind bekommen konnte. Ich wusste auch, dass es dazu einen Mann bedurfte. Aber wie das Weitere von statten ging, das wusste ich nicht. Woher auch? Auf dem Hof meiner Eltern hatte das Schwein Jahr für Jahr Ferkel bekommen. Die Hühner hatten Eier gelegt. Die Kuh hatte ein Kalb bekommen, und dazu war es notwendig gewesen, zum Bullen des Großbauern oder zum Eber des Nachbarn zu gehen. Ich hatte gesehen, dass der Hahn die Henne besprang, dass der Eber die Sau bestieg und der Bulle die Kuh. Doch als ich die Mutter fragte, was die Tiere da trieben, hatte sie nur beschämt den Kopf geschüttelt und mich weggezogen. Sie hatte, als ich ihr eines Tages völlig verstört das Blut zwischen meinen Beinen gezeigt hatte, meine Hand genommen und mir gezeigt, wie ich die Monatshygiene zu betreiben hatte und dass ich mich ab sofort vor den Burschen in Acht nehmen musste. Mehr hatte sie nicht gesagt. Woher also sollte ich wissen, wie ein Kind entstand? „Aber die Herrin teilt doch ihr Bett mit dem Medicus Braunert?“, wunderte ich mich. „Ja, das ist ja eben das Sonderbare“, gab Friedlinde zurück. „Vermutlich kann die Herrin keine eigenen Kinder bekommen. Das ist bitter. Da kann man schon daran zerbrechen“, meinte sie.
Wenn das so war, konnte ich die Herrin verstehen. Sie tat mir fortan sogar leid. Das Gespräch mit der Köchin hatte mir geholfen, das Verhalten meiner Herrin annehmen zu können. Jetzt nahm ich es nicht mehr persönlich, wenn sie mich so barsch anfuhr oder durch mich hindurchzublicken schien. Aber ich fragte mich, ob sich die Herrschaften wohl auch mit denselben Blicken anschauten, die es so warm machten im ganzen Körper. Und ich kam zu dem Schluss, dass sie es vielleicht nicht taten, denn sonst wäre da ja ganz viel Wärme, und in diese Wärme hinein könnte man doch auch gut ein Kind pflanzen. So dachte ich mir das. Also bedachten der Herr und ich uns weiterhin heimlich mit tiefen Blicken.
Eines düsteren Wintertages im Dezember, als man das Gefühl hatte, der Tag sei schon gleich am Morgen in den Abend übergegangen, da trat mir der Medicus Braunert in den Weg. Anders als sonst, hob er seine Hände und legte sie mir auf die Schultern. Es war die erste Berührung und erstarrte vor Schreck. „Magdalena, ich halte es nicht länger aus!“, sprach er leise. Ichverstand nicht recht, was genau er damit meinte, und doch jagten mir seine Worte einen wohligen Schauer über den Rücken. Fragend blickte ich ihn an, und das schien er als Zustimmung zu verstehen. Er schaute sich um, um sich zu vergewissern, dass uns keiner beobachtete und zog mich dann in die kleine Kammer neben seinem Behandlungsraum, wo er seine Medizin aufbewahrte.
Mein Herz klopfte so stark, als wollte es gleich zerspringen, und meine Kehle war so trocken, dass ich kaum schlucken konnte. Der Herr hob seine Hand und strich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie war unter der weißen Haube hervorgerutscht. Seine Berührung fühlte sich glühend heiß an, und ich zuckte erschrocken zurück. „Ssshhh“, machte er sanft und legte mir seinen Finger auf den Mund. Ein fast unerträgliches Brennen durchfuhr mich. Es war noch viel stärker als das, was ich bei unseren Blicken verspürt hatte. Zum ersten Mal blickte ich länger in seine Augen. Sie waren von einem tiefen Blau, und sie schienen mich zu durchdringen bis in die letzte Faser meines Körpers. ‚Weshalb schaut ihr mich so an?‘, hätte ich gerne gefragt, doch kam kein Laut über meine Lippen. Stattdessen nahm er meinen Kopf zwischen seine Hände und näherte sich langsam meinem Gesicht. Fast wurde mir schwindelig, und ich musste die Augen schließen. Da trafen seine vollen Lippen auf meinen Mund. Ich hatte das Gefühl, als würden meine Knie nachgeben, als würde ich in weiche Daunen versinken, doch als ich die Augen öffnete, stand ich auf dem Steinfußboden in seiner Kammer neben dem Behandlungszimmer. Ich wagte kaum zu atmen, diese Berührung, dieser Kuss, seine Nähe, sein Duft, seine tiefe Stimme, all das kam mir so unwirklich vor. Das Einzige, was ich wusste war, dass ich mir wünschte, es möge nie mehr aufhören. „Ich begehre dich, Magdalena, und ich spüre, dass du mich auch begehrst“, sagte er leise, und wieder lief ein wohliger Schauer über meinen Rücken. Ja, wenn dieses Gefühl ‚begehren‘ hieß, dann begehrte ich auch ihn. „Ihr solltet das mit eurer Frau tun.“ Meine Stimme klang, als würde ein alter Rabe heiser krächzen. „Das geht nicht. Meine Frau begehrt mich nicht und ich sie nicht.“ Ich schwieg, denn ich verstand nicht, was seine Worte bedeuten sollten. „Aber ihr seid Mann und Frau“, sagte ich fragend. „Das bedeutet noch lange nicht, dass man sich auch begehrt, Magdalena“, erklärte mein Herr. „Eine Magd sollte sich dennoch nicht von ihrem Herrn berühren lassen.“ Ich senkte meinen Blick und versuchte, einen Schritt zurückzugehen. Doch die steinerne Wand war in meinem Rücken. Er musste gemerkt haben, dass ich ihm auszuweichen versuchte, deshalb sagte er: „Ich werde nichts tun, was du nicht auch willst.“ Sein Blick ließ mich nicht los. Ich musste schlucken. „Ich sollte wieder in die Küche gehen, Friedlinde wartet schon auf mich“, sagte ich leise und drückte mich an ihm vorbei. Mit dem Ellbogen schob ich die Tür auf, die nur angelehnt war. Hektisch blickte ich den Gang hinauf und hinunter, doch es war niemand zu sehen. Eilig huschte ich hinaus.
Mein Herz klopfte immer noch bis zum Hals, und meine Wangen fühlten sich an, als hätte ich glühende Kohlen daraufgelegt, als ich zu Friedlinde in die Küche kam. Sie blickte mich an, und ich wusste, dass sie alles durchschaute. Aber sie sagte kein Wort.
3. Kapitel
Ich möchte ihr zeigen, wie es mir ergangen ist, doch sie kann es nicht zulassen. Noch nicht. Der Tag wird kommen.
Liz hatte sich entschieden. Es war eine unruhige Nacht gewesen, sie hatte viel nachgedacht, und als sie endlich eingeschlafen war, wieder völlig wirr geträumt, gerade so, als wäre sie in eine andere Zeit versetzt. Doch als sie am Morgen nach dem Besuch in Mulfingen aufgewacht war, noch bei Oma Doro, da hatte sie es gewusst. Sie würde die Stelle annehmen. Sie würde sich eine Wohnung suchen, und sie würde umziehen. Marcel würde es schon verstehen. Eines Tages würde er es verstehen. Bestimmt würde er das. Er würde nicht ihrem Glück im Weg stehen wollen. Das hatte sie gedacht. Sie hatten sich verabredet und wollten schön zum Essen gehen. Da würde sie es ihm, bei Kerzenlicht und gutem Essen, erklären können. So hatte sie sich das vorgestellt.
Die Wirklichkeit sah aber so aus, dass er völlig konsterniert reagierte. Er hatte gar nicht gewartet, bis sie im Lokal waren. „Ist dir klar, dass du da allein hingehen wirst?“, fragte er. Liz zuckte nur mit den Schultern und erwiderte: „Warte doch einfach mal ab, bis ich mich dort eingelebt habe. Vielleicht gefällt es dir ja auch.“ „Pfft!“, schnaubte er verächtlich, drehte sich ab und tat so, als würde er den Aushang am Kino studieren. Sie betrachtete ihn von hinten und sah, wie er schwer durchatmete, um sich zu beruhigen. Jetzt war es besser, nichts zu sagen, das spürte sie. „Liz, dort ist der Hund begraben. Da gibt es wahrscheinlich noch nicht einmal ein Kino“, lamentierte er nach einigen Minuten aufs Neue. „Ich reise doch nicht ins Mittelalter“, konterte Liz. Seine Augen funkelten wütend. „Liz, ich habe keine Lust auf eine Wochenend-Beziehung!“, knallte er ihr entgegen. Seine Worte taten ihr weh. Sie spürte, was sie bedeuten könnten. Aber sie wollte es nicht wahrhaben. „Weißt du, dass du gerade auf eine ganz miese Art versuchst, mich zu manipulieren?“, schrie sie ihn an. „Ach ja, tue ich das? Merkst du das also noch? Ich dachte, du bist schon so im Landlust-Fieber, dass du gar nichts anderes mehr wahrnimmst!“, schrie er zurück. „Warum sollte es denn nicht funktionieren, wenn wir uns nur am Wochenende sehen?“, versuchte Liz in ruhigerem Ton einzulenken.
„Ach Liz,“ seufzte Marcel traurig, „ich dachte, wir suchen uns eine schicke Wohnung und richten uns die gemeinsam her. Wie soll das denn gehen, wenn du fast 200 Kilometer weit weg wohnst? Da hast du deine eigene Wohnung in Arschhausen, und ich bleibe in meiner kleinen Wohnung, weil alles andere unvernünftig und zu teuer wäre. Am Wochenende ist immer jemand auf der Autobahn unterwegs, ich kann mir das einfach nicht vorstellen!“ Liz schluckte. „Heißt das, du möchtest dann lieber unsere Beziehung beenden?“, fragte sie. Es fiel ihr schwer, die Frage auszusprechen, aber sie wusste, dass sie ohnehin über ihnen schwebte. Marcel drehte sich ruckartig ab und schwieg. „Marcel? Ich habe dich was gefragt“, sagte Liz sanft und legte ihre Hand vorsichtig auf seine Schulter. Er schüttelte sie ab, als sei sie ein lästiges Insekt. „Das weiß ich nicht. Im Augenblick weiß ich einfach nicht, was ich denken soll. Versuche bitte, mich zu verstehen. Ich glaube, ich brauche Zeit“, sagte er leise. „Okay. Dann geh ich jetzt besser allein nach Hause“, meinte Liz, wandte sich ab, doch hielt noch einen Augenblick abwartend inne, ob er es sich nicht vielleicht doch noch anders überlegen und ihr hinterhergehen würde, um sie aufzuhalten. ‚Er könnte mich jetzt auch einfach nur in den Arm nehmen‘, dachte sie und fühlte Trauer und Wut zugleich in sich aufsteigen. Was es auch immer war, es machte, dass die Tränen kamen.
Und als sie durch die laue Sommernacht zu ihrer WG ging, war ihr egal, dass ihre Wangen tränennass waren und was die Menschen denken mochten, denen sie begegnete. In der WG war Paul in der Küche, als sie in die Wohnung trat. „Nanu, Liz, was los?“, fragte er, als er in ihr Gesicht blickte. „Ach, es ist wegen Marcel…“, stieß sie wütend hervor. „Er findet es nicht gut, dass du Karlsruhe verlässt und ihm damit auch den Rücken zuwendest?“, mutmaßte Paul. „Bingo!“, sagte Liz und lächelte bitter. „Er findet, dass dadurch auch unsere Beziehung keine Zukunft hat“, setzte sie hinzu. Paul schnaubte verächtlich. „Wenn er das wirklich denkt, dann hat eure Beziehung vielleicht wirklich auch keine Zukunft, findest du nicht?“ Liz zuckte mit den Schultern. „Ich weiß nicht…“, murmelte sie und blickte angestrengt auf den Boden, denn sie spürte, wie erneut eine Welle bitterer Enttäuschung durch ihren Körper rollte und die Tränen in die Augen trieb.
Wieso hatte sie das Gefühl, dass da was nicht ganz richtig lief? Dass ihr WG-Mitbewohner, dem sie erst neulich von ihrem Zwiespalt mit der Stelle und ihren Überlegungen erzählt hatte, sie besser verstand als ihr Freund Marcel, mit dem sie jetzt schon so lange zusammen war? Paul stupste sie aufmunternd in die Seite. „Ich finde, du machst alles ganz genau richtig, Liz! Du hast auf dein Herz gehört, als du dich entschieden hast, diese Stelle anzunehmen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Komm, Schluss mit Trübsal blasen, ich bin heute versetzt worden, gehen wir einen trinken.“ Liz lächelte und schniefte. „Nee, lass mal, Paul, so verheult geh ich nicht mehr unters Volk“, sagte sie. „Dann hol ich uns Bier an der Tanke und wir knallen uns vor die Kiste, wie hört sich das an?“ Das klang gut. Ein gemütlicher Abend auf der alten, durchgesessenen WG-Couch, das war jetzt besser, als allein im Zimmer zu hocken und schwere Gedanken zu wälzen.
Seit dieser Berührung, seit diesem Kuss, suchte ich mehr denn je die Nähe zu meinem Herrn und hatte zugleich Angst davor. Doch schämte ich mich auch für das, was da geschehen war und hatte Sorge, dass Friedlinde mich durchschaut hatte und denken würde, ich schlüge ihre Warnungen in den Wind. So versuchte ich, wenngleich ich voller Sehnsucht nach einer erneuten Berührung dieser Art war, in den nächsten Tagen zu vermeiden, dass ich allein im Haus unterwegs war, wenn die Gefahr bestand, ich könnte dem Herren Medicus begegnen. Doch dass der Tag kommen würde, an dem das Unvermeidbare geschehen würde, hatte ich längst geahnt.
Traurig war sein Blick, als wir uns begegneten. Es war gar nicht im Haus, sondern als ich auf dem Weg zum Markt war. Draußen hatte ich ihn noch nie gesehen, deswegen fühlte ich mich wie versteinert, als er plötzlich vor mir stand, mit seinem dunklen Mantel, den eleganten Hut tief ins Gesicht gezogen und mit seinem ledernen Arztkoffer in der Hand. „Du weichst mir aus, Magdalena“, stellte er fest. Ich senkte verlegen meinen Blick. „Es ist nicht rechtens, was wir getan haben, mein Herr“, sagte ich leise. „Aber war es denn nicht schön?“, fragte er. Ich sah für einen kurzen Moment in seine Augen. Wie heiße Nadeln durchfuhr es mich. Das genügte ihm als Antwort. „Es ist unser kleines Geheimnis, Magdalena“, sprach er leise. „Ich bewahre es ganz tief hier drin auf“, und er zeigte auf seine Brust. „Bestrafe mich nicht derart drakonisch, indem du mir tagelang ausweichst, wenn du es doch auch als schön empfindest.“ Und damit nickte er mir zu, als habe er mir eben als mein Dienstherr noch einen Auftrag für eine Besorgung gegeben.
Ich war so neben mir, dass ich gar nicht wusste, wie ich eigentlich auf den Markt gekommen war. Ratlos stand ich vor dem Wagen der Fischverkäuferin und wusste nicht mehr, was ich besorgen sollte. Fisch war es jedenfalls nicht gewesen. Woher wusste er, dass ich es auch als schön empfunden hatte? Er hatte es einfach so festgestellt. Konnte er in mein Herz blicken? Als ich mit dem Korb zurück in die Küche kam und Friedlinde ratlos den Kopf schütteln sah, war mir klar, dass ich nicht das gekauft hatte, was sie mir aufgetragen hatte. „Wo bist du nur mit deinen Gedanken, Magdalena?“, fragte sie mich, ohne eine Antwort zu erwarten. Ich zuckte nur mit den Schultern und stand mit gesenktem Kopf da. „Lass es nicht so weit kommen, Mädchen,“ sagte die Köchin, woraufhin ich heftig den Kopf schüttelte. Was meinte sie wohl mit ‚so weit kommen‘? War das, was bereits geschehen war, dass die Lippen des Herren Medicus die meinen berührt hatten, schon ‚so weit kommen‘? Oder gab es da noch mehr? Etwas in mir ahnte, dass es noch etwas geben musste, das mehr war oder tiefer ging. Ich wusste ja nichts über diese Sache zwischen Mann und Frau, außer, dass man das Bett teilen musste, um ein Kind eingepflanzt zu bekommen. Das hatten wir nicht getan. Also war es nicht ‚so weit gekommen‘. Ein wenig schmunzeln musste ich bei dem Gedanken daran, dass der Medicus plötzlich in meine Kammer unter dem Dach steigen würde und sich in mein schmales Bett auf den Strohsack legen würde. Das wäre absolut unter seiner Standeswürde, soweit würde es niemals kommen. Ein wenig beruhigte mich das.
Und nachdem ich mir auf diese Weise meine Welt wieder ein wenig geradegerückt hatte, konnte ich mich glücklicherweise wieder auf meine Arbeit besinnen und ging in die Waschküche, um unter dem Kessel Feuer zu machen. An diesem Tag begegnete ich dem Herren Medicus nicht mehr. Doch am anderen Tag, als ich den Herrschaften das Frühstück servieren sollte, bemerkte ich, dass der Platz der Herrin leer war und nur er zu Tische saß. Als ich das Zimmer betrat, hob er seinen Blick und sah mich direkt an. Meine Knie gaben ein wenig nach, und ich musste mit einer Hand Halt suchen an der schweren, eichenen Anrichte. „Meine Frau ist unpässlich“, sagte der Medicus. „Vielleicht hat sie sich den Magen verdorben. Lass bitte der Köchin ausrichten, sie möge ihr eine leichte Brühe zubereiten.“ Ich machte meinen Knicks und wollte gehen, um seiner Anweisung Folge zu leisten, doch da sah ich im Augenwinkel, wie er seine Serviette, welche er sich in den Hemdkragen gesteckt hatte, herauszog, auf den Tisch legte, wie er hastig aufstand und zu mir trat. „Magdalena“, sagte er leise. Seine tiefe, sonore Stimme ließ alles in mir erzittern. Er hob seine Hand und berührte sacht meine Wange. „Magdalena, ich verzehre mich nach dir.“ Wenngleich ich nicht wusste, was das Wort bedeutete, ließ es heiße Wellen durch meinen Körper rollen. Er musste meinen fragenden Blick erhascht haben, denn er lächelte, nahm meinen Kopf zwischen seine feinen Hände und küsste mich. ‚Es ist nicht rechtens‘, hämmerte es in mir, ‚aber es ist wunderschön‘, hämmerte es dagegen. „Lass es zu, Magdalena“, flüsterte er mir sanft in mein Ohr. Und so schloss ich die Augen und begann, das zu erwidern, was er tat. Ich kann nicht beschreiben, wie es sich anfühlte, da ich so etwas noch nie zuvor erlebt oder erfahren hatte. Doch ich weiß, dass es einzigartig und wunderschön war und ich in dem Augenblick wünschte, die Welt würde aufhören sich zu drehen und es würde niemals enden.
4. Kapitel
Sie kommt mir näher und näher, und ich werde es ihr zeigen können. Bald. Auch ich muss Geduld haben.
„Vielleicht ist es besser so, wenn du nicht direkt am Schulort wohnst“, hatte Oma Doro gesagt. Liz war anfangs sehr enttäuscht gewesen, dass es nicht mit einer Wohnung in Jagstberg funktioniert hatte. Doch inzwischen hatte sie sich gut eingelebt und schon das ein oder andere Mal gedacht, dass ein bisschen Abstand zum Schulort vielleicht doch nicht ganz verkehrt war. Sie war in der vorletzten Ferienwoche umgezogen. Ihre Wohnung lag in einem kleinen Dorf, das ebenfalls auf einem Berg und eigentlich nur wenige Kilometer von Mulfingen entfernt lag. Es hieß Mäusberg, und der Name war passend, da es wahrscheinlich mehr Mäuse, Katzen und Rinder als Menschen gab.
Sie hatte eine kleine Einliegerwohnung gefunden, die großzügig geschnitten war und eine große Terrasse hatte, von der aus man einfach nur über Wiesen und bis zum nahegelegenen Wald blicken konnte. Marcel hatte ihr beim Umzug geholfen und war auch eine Nacht geblieben. Aber es hatte sich nicht richtig angefühlt. „Findest du es nicht wunderschön hier?“, hatte sie ihn gefragt, als sie abends noch zusammen auf der Terrasse gesessen und ein Glas Wein getrunken hatten. „Ja, natürlich ist es eine schöne Landschaft. Aber ganz ehrlich, Liz, das geht dir doch spätestens nach 14 Tagen dermaßen auf den Zeiger, dass du dich nach Leben in der Stadt zurücksehnen wirst. Denk an meine Worte. Hier versumpfst du, und keiner wird es merken, weil hier sowieso der Hund begraben ist.“
Als Marcel in sein Auto gestiegen war und sie ihm hinterherblickte, versuchte sie vergeblich, so etwas wie Wehmut oder Abschiedsschmerz in sich zu verspüren. Eigentlich war sie froh, dass er gefahren war. Seine Anwesenheit schien sie zu blockieren und ihre Antennen abzuknicken, so als könne sie in seiner Gegenwart nicht das empfangen, was es hier in ungeahnter Fülle zu empfangen gab: Frische Luft, sattes Grün, grenzenlos scheinende Weite, tiefe Ruhe und ein alles durchdringender Frieden. Den Ohrensessel von Opa hatte sie so aufgestellt, dass sie auf ihre Terrasse blicken konnte, wenn sie es sich darin gemütlich machte. Ihre Vermieter waren sehr nett; ein älteres Ehepaar, dessen Kinder schon erwachsen und ausgezogen waren. Sie waren nicht aufdringlich, aber herzlich. Wenn man sich zufällig begegnete, tauschte man ein paar freundliche Floskeln aus, aber Liz hatte bisher nicht das Gefühl, dass sie sich einmischen würden oder zu neugierig waren. So konnte es bleiben. Einmal hatte sie eine lange Wanderung gemacht, einfach den Berg hinunter und durch den Wald, und sie war oberhalb ihrer neuen Schule herausgekommen. Mit klopfendem Herzen war sie vor dem Gebäude gestanden, hatte sich aber nicht getraut, näher hinzugehen.
Auf die erste Lehrerkonferenz morgen war sie schon sehr gespannt und zugleich auch ein wenig nervös, was sie erwarten würde, welche Klasse sie bekäme, wie der Stundenplan aussehen würde und wie die anderen Kolleginnen und Kollegen sie wohl empfingen. Das Einzige, was ihr wirklich Sorge bereitete, war die Tatsache, dass sie seit Wochen so schlecht schlief. Anfangs hatte sie gedacht, es läge vielleicht an der Hiobsbotschaft vom Schulamt, dann an der ausstehenden Entscheidung, ob sie die Stelle annehmen sollte, dann an dem Knacks in der Beziehung zu Marcel, jetzt versuchte sie es auf den Schulbeginn und die neue Schule zu schieben. Manchmal war sie tagsüber so müde, dass sie das Gefühl hatte, im Stehen einschlafen zu können. Um die Müdigkeit zu vertreiben, wuselte Liz in ihrer kleinen Wohnung herum, räumte die letzten Bücher und Ordner in das große Wandregal, das in ihrem Arbeits- und Schlafzimmer stand und schaute zwischendurch immer wieder nach dem Kuchen, der aus dem Backofen bereits einen verheißungsvollen Duft entströmen ließ.
Oma Doro hatte sich für heute angekündigt, und darüber war sie froh. So war sie ein wenig abgelenkt und musste nicht zu viel über den morgigen Tag nachdenken. Kurz später klingelte es, und Liz eilte zur Wohnungstür, um ihrer Großmutter zu öffnen. „Hallo, Oma, schön, dass du da bist.“ Oma Doro schloss ihre Enkeltochter in ihre Arme und drückte sie einfach nur ganz fest. „Mein großes Mädchen, was bin ich stolz auf dich. Jetzt zeig mir mal dein neues Reich, ich bin schon sehr gespannt“, und neugierig drängte sich die Großmutter an Liz vorbei in die Wohnung. Liz musste breit grinsen und eilte dann an ihr vorbei, um die Führung durch die kleine Wohnung wieder selbst übernehmen zu können. „Am besten gefällt mir der Blick aus dem Wohnzimmer“, beendete Liz den Rundgang. „Dass du Opas Sessel immer noch hast, freut mich wirklich…“, murmelte die Großmutter und strich gedankenverloren über die Rückenlehne des Ohrensessels. „Natürlich, den gebe ich nicht her. Das ist mein Lieblings-Möbelstück, Oma!“, empörte sich Liz. „Der Kuchen ist leider noch ein bisschen warm“, meinte Liz entschuldigend, als sie sich an den Kaffeetisch setzten. „Ach, so schmeckt er mir auch viel besser“, meinte Oma Doro. Auch wenn sie das vielleicht nur so sagte, aus ihrem Mund klang es herzlich und aufrichtig, und deswegen war es auch in Ordnung.
„Hast du dich denn schon eingelebt?“, wollte Oma Doro wissen. „Ja, ich glaube schon“, gab Liz zur Antwort. „Ich schlafe noch ein wenig unruhig und muss mich auch an diese absolute Ruhe gewöhnen. Weißt du, es ist wirklich unbeschreiblich dunkel hier nachts. Da ist weit und breit nicht ein einziges Licht zu sehen. Aber grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl und genieße es, meine eigenen vier Wände zu haben.“ Die Großmutter blickte ihre Enkeltochter nachdenklich an. „Ich finde tatsächlich, du siehst nicht wirklich erholt aus. Du hast dunkle Ringe unter den Augen. Was belastet dich?“ Liz winkte ab. „Es ist sicher nur die Umstellung. Ich träume nachts manchmal komische Dinge, kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern, aber es fühlt sich an, als würde der Traum in der nächsten Nacht weitergehen.“ „Das klingt doch spannend“, sagte die Großmutter. „Nichts passiert ohne einen Sinn.“ „Du immer mit deinen schlauen Sprüchen, Oma“, lachte Liz. „Aber es ist echt ein bisschen nervig, dass ich so wenig Schlaf finde. Ich fühle mich manchmal wie gerädert, und dabei waren doch Ferien.“ Oma Doro begann in ihrer Handtasche zu kramen und holte ein kleines Fläschchen hervor. „Hier“, sagte sie, „das ist Baldrian. Davon nimmst du am Abend einen Teelöffel und noch einen zweiten direkt, bevor du ins Bett gehst.“ Liz nahm das Fläschchen und drehte es nachdenklich in der Hand. „Keine Sorge, das ist was Pflanzliches“, beruhigte die Großmutter sie. Liz stand auf und ging um den Tisch, um ihre Oma fest zu drücken. „Danke, Oma“, murmelte sie in das weiße Haar der alten Dame. Was täte sie nur ohne Oma Doro.
„Haben sich deine Eltern eigentlich die Wohnung schon angeschaut?“, wollte die Großmutter wissen. Liz senkte den Kopf und schüttelte den Kopf. „Du weißt doch, dass ich die große Enttäuschung in der Familie Breitner bin. Ich bin nun mal nicht in die Fußstapfen meiner Eltern und Großeltern getreten.“ „Ach, papperlapapp“, sagte die Großmutter ruppig. Und um ihrem gemeinsamen Nachmittag die Leichtigkeit zurückzugeben, begann sie ein wenig aus ihrem Rentner-Alltag zu plaudern.
Die folgenden Stunden vergingen wie im Flug. Liz fand es immer wieder erstaunlich und bewundernswert, wie aktiv ihre Großmutter war und wie jung sie im Grunde doch geblieben war. Aber wahrscheinlich eben genau durch Dinge wie Gedächtnistraining, Qi-Gong und Bowlinggruppe, die sie die ganze Woche über so machte.
„Und wie läuft es mit Marcel und dir?“, brachte Oma Doro schließlich doch noch das Thema zur Sprache, von dem Liz sich nicht sicher gewesen war, ob sie überhaupt darüber sprechen wollte. Nachdenklich zuckte sie mit den Schultern. „Das kann ich überhaupt nicht beantworten“, meinte sie dann. „Eigentlich läuft es gar nicht, wenn ich ehrlich bin.“ Die Großmutter sah ihre Enkeltochter aus ihren warmen Augen an, griff über den Tisch und nahm Liz‘ Hände in die ihren. „Erzähle deiner alten Großmutter darüber“, sagte sie und lächelte ihr aufmunternd zu. Liz atmete tief durch. „Ach, Oma, ich glaube nicht, dass das mit Marcel und mir eine Zukunft hat. Weißt du, er war einmal mit mir hier, als ich eingezogen bin. Da hat er mir auch echt viel geholfen. Aber … ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll… es fühlte sich falsch an, als er hier übernachtet hat, als wäre er ein Störfaktor in dieser Wohnung.“ „Aber diese Wohnung mit diesem herrlichen Ausblick ist doch etwas Wunderbares, kann er deine Entscheidung denn nicht akzeptieren?“ Liz schüttelte den Kopf: „Ich glaube, er fände so eine Wohnung höchstens schön, um ein Urlaubs-Wochenende zu verbringen, aber länger könnte er es nicht aushalten. Er hatte an allem was auszusetzen. Wie es riecht, dass es so ruhig ist, dass man hier nichts tun kann, dass man zu allem ein Auto braucht… stell dir vor, dass mich die Hauseigentümer gegrüßt haben und mit mir ein paar Sätze gewechselt haben, das fand er übergriffig und aufdringlich! Aber mich hat es einfach nur gefreut, eigentlich. Doch ich konnte in seiner Gegenwart keine eigenen Gedanken formulieren, er machte alles so negativ, wenn du weißt, was ich meine.“ Oma Doro nickte verständnisvoll. „Meine Liebe, alles hat seine Zeit. Die Zeit mit Marcel hatte seine Zeit. Wenn er dir hierher nicht folgen kann und dein Glück nicht teilen möchte, dann musst du ihn vielleicht einfach ziehen lassen.“ Liz nickte. „Komisch ist, dass er mir auch kein bisschen fehlt. Dabei waren wir jetzt echt lange zusammen und hatten ja gemeinsam richtig große Pläne. Lass uns über was anderes reden, Oma. Ich bin schon ziemlich aufgeregt wegen morgen.“
Und dann plauderten die beiden noch über die neue Schule und alte Zeiten, und im Nu war der Nachmittag vorüber und die Großmutter drängte zum Aufbruch. „Ich wünsche dir, dass du ein großartiges Kollegium und eine nette Klasse bekommst. Du wirst sehen, wenn du morgen um diese Zeit hier sitzt, kannst du dich einfach nur noch auf den ersten Schultag freuen.“ Liz umarmte ihre geliebte Großmutter zum Abschied. „Oma, hast du noch einen Ratschlag für mich?“, fragte sie. Oma Doro wusste einem nämlich immer etwas Wertvolles mit auf den Weg zu geben. „Ja, den habe ich: Sei du selbst.“
Über diese Worte musste Liz noch lange nachdenken. Vor allem nachts, als sie wieder einmal keinen Schlaf finden konnte. Sie war nervöser als ihr lieb war und wälzte sich unruhig von einer Seite auf die andere. Es war tagsüber ungewöhnlich heiß für September gewesen, selbst am Abend hatte es nicht so abgekühlt, wie es zu erwarten gewesen wäre. In ihrem Schlafzimmer war es warm und stickig. Liz warf sich auf den Rücken und starrte ungeduldig an die Zimmerdecke. Sie ließ ihren Blick zu ihrem Schreibtisch, ihrem Kleiderschrank und ihrem vollen Bücherregal wandern. Ihre Schultasche aus Leder stand fertig gepackt neben dem Tisch. Es war ein Geschenk ihrer Eltern gewesen zum Beginn des neuen Lebensabschnitts als Lehrerin, und als ihr Vater sie ihr mit den Worten „gut gemacht, Liz“ überreicht hatte, war sie fast rot geworden vor Stolz. Sie wusste, dass sie ihren Vater mit ihrer Berufswahl enttäuscht hatte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte sie Medizin studieren sollen, wie schon so viele Generationen vor ihr es getan hatten.
‚Was soll ich anziehen?‘, überlegte sie und ärgerte sich darüber, dass sie sich mit solchen Gedanken das Einschlafen zusätzlich erschwerte. Jetzt war Liz hellwach. Ob es auf der Terrasse inzwischen vielleicht etwas kühler war? Zumindest ein Durchzug konnte nicht schaden, überlegte sie, denn hier im Schlafzimmer schien die Luft zu stehen. So stand Liz mitten in der Nacht auf. Es war fast unheimlich dunkel. In der Stadt hatte es zu jeder Zeit der Nacht Lichter gegeben: Da waren Straßen bis in die frühen Morgenstunden beleuchtet, da blinkten Reklametafeln, sprangen die Ampeln von Rot auf Grün und wieder zurück, da fuhren Autos und hupten, völlig gleichgültig zu welcher Uhrzeit. Hier auf dem Land war nachts absolute Ruhe. Da fuhr kein Auto, und Ampeln gab es sowieso weit und breit keine einzige. Als sie die Terrassentür öffnete, war das einzige Licht, das nach außen drang, das Licht aus ihrem Wohnzimmer. Und weil sie es unpassend fand, löschte Liz das Licht und stellte sich in die geöffnete Tür. Hier war es nun doch deutlich kühler, als in der Wohnung, und dazu war ein leichtes Lüftchen zu spüren. Ach, das tat gut. Liz hob die Arme, streckte sich, so weit sie konnte, nach oben und ließ dann den Oberkörper nach vorn fallen. So stand sie da, atmete tief ein und aus und wiederholte das Ganze noch ein paar Mal. Im Yogakurs, den es an der Pädagogischen Hochschule mal zwei Semester lang gegeben hatte, hatten sie oft so begonnen. Dieses „Alles-einfach-Hängen-Lassen“ war eine Technik, die sie seither in ihren Alltag integriert hatte, das tat ihr gut.
Als sie sich wieder aufrichtete, holte sie tief Luft. Die Kühle der Septembernacht durchdrang ihre Lungen und machte ihren Kopf frei von allen belastenden Gedanken. Was für ein wunderschönes Fleckchen Erde war das hier. Keine Sekunde hatte Liz mehr daran gezweifelt, dass ihre Entscheidung richtig gewesen war, die Stelle in Hohenlohe anzunehmen. Mit einem zufriedenen Seufzer ließ sie sich auf ihre aus Europaletten selbst gezimmerte Lounge fallen und schloss die Augen. Eine sanfte Brise spielte mit ihren Haaren. Eine besonders widerspenstige Strähne wollte sich immer über ihren Mund legen, und sie versuchte vergeblich, sie wegzupusten.
Plötzlich war ihr, als würde ihr eine unsichtbare Hand die Haarsträhnen aus dem Gesicht streichen. Erschrocken drehte sich Liz um und schalt sich zugleich einen Dummkopf ob der Annahme, da könnte jemand aus der Dunkelheit aufgetaucht sein. „Hier ist doch niemand“, sagte sie halblaut zu sich selbst und mehr, um sich Mut zu machen. Wie merkwürdig ihre Stimme in diese Stille hinein klang. Sie versuchte, sich auf ihre Atmung zu konzentrieren. Doch wieder war es, als würde sie etwas berühren. ‚Bestimmt sind das Windböen‘, dachte sie, hier ist doch weit und breit niemand‘. Sicherheitshalber ging sie in ihr Wohnzimmer und machte Licht. „Hallo? Ist da jemand?“, sagte sie und wollte mutiger klingen, als sie plötzlich war. Sie spürte, wie ihr Herz immer schneller schlug. Nein, da draußen im Dunkeln war es ihr jetzt doch zu unheimlich. Schnell schloss sie die Tür und kontrollierte sicherheitshalber auch die Wohnungstür, machte einmal alle Lichter an, schaute in jeden Winkel, auch hinter den Duschvorhang im Bad, dort nur mit zitternden Händen, aber die Wohnung war leer. ‚Das habe ich mir nur eingebildet, das war ein Windstoß‘, sagte sie sich.
Da fiel ihr der Baldrian von Oma Doro ein. Sie holte das Fläschchen und nahm einen Teelöffel voll.
Ich hatte nun gespürt, was ‚sich verzehren‘ bedeutete. Es war das sehnsüchtige Warten auf die nächste Gelegenheit, bei der der Medicus und ich ungestört Blicke, Berührungen oder Küsse austauschen konnten. ‚Sich verzehren‘ bedeutete wohl auch, dass man immer mehr davon haben wollte, dass das Verlangen danach immer größer wurde und man es kaum aushalten konnte, wenn die Abstände dazwischen größer waren. ‚Sich verzehren‘ hieß auch, dass man nachts in seiner Kammer lag und sich wünschte, das Unmögliche möge geschehen und er stünde plötzlich in der Tür, und man ließe ihn ein und er legte sich dazu. ‚Sich verzehren‘, diese zwei Worte hatten plötzlich eine Bedeutung für mich, eine süße und eine bittere. Schmerzlich für mich war auch, dass es sich anfühlte, als wäre es nicht richtig. Und ich spürte, dass Friedlinde es wusste. Aber sie sagte nichts, und das war noch viel schlimmer. Hätte sie mich doch darauf angesprochen, würde sie doch endlich sagen: „Ich weiß genau, was da vor sich geht.“ Dann hätte ich mich erklären können, hätte endlich darüber reden können und es nicht länger heimlich mit mir umhertragen müssen. Doch sie sagte nichts, sie schaute nur. Wenn ich mit meinen ‚Sich-verzehren‘-Gedanken allein war, fühlte ich mich weniger schuldig, doch wenn diese Gedanken oder Empfindungen in mir aufwallten, wenn die Köchin in der Nähe war oder wenn ich ihr unter die Augen trat, war es ganz schlimm für mich, denn mir war bewusst, dass ich es nicht vor ihr verbergen konnte, wie aufgewühlt es in mir aussah, so als sei die Röte auf meinen Wangen der Spiegel meiner Seele. Trotz allem wusste ich, dass mich die alte Köchin auf ihre Weise in ihr Herz geschlossen hatte und dass sie es wahrscheinlich nicht böse meinte, sondern nur besorgt um mich war. Dieser unausgesprochene Vorwurf stand die ganze Zeit zwischen uns.
So war ich geradezu erleichtert, als sie sich mir eines Tages in den Weg stellte. „Magdalena!“, herrschte sie mich mit strenger Stimme an, die mich regelrecht zusammenfahren ließ. „Magdalena, es verloren schon Mägde ihre Stellung wegen solcher Verfehlungen!“ Ich sah sie fragend an, und es fiel mir schwer, die Worte über die Lippen zu bringen. „Was meinst du mit ‚Verfehlungen‘, Friedlinde? Meinst du ‚sich verzehren‘?“ Die Köchin starrte mich entgeistert an. „Was redest du da? Es geht um Unzucht, Magdalena!“ Ich verstand nicht, was sie meinte. „Ich…ich weiß nicht, was du damit meinst, Friedlinde,“ stammelte ich verlegen. „Ich sehe es, mit welchen Blicken er dir hinterherstarrt, der Medicus. Ich sehe es, wie du errötest, wenn er den Raum betritt. Ich merke, dass er häufiger als nötig wäre in unsere Wirtschaftsräume kommt, nur um dich zu sehen. Hat er dich unsittlich berührt?“ Ich zuckte die Schultern, denn mir war nicht klar, was sie mit ‚unsittlich‘ meinte. „Ja, berührt hat er mich, aber es war nicht unsittlich, es war sehr schön“, wagte ich zu sagen. Friedlinde lachte laut schnaubend auf. „Das dachte ich mir“, zischte sie verächtlich, „so fängt es meistens an. Den Kopf verdreht hat er dir unschuldigem Ding. Magdalena, ist er schon bei dir gelegen?“ Entsetzt riss ich die Augen auf. „Nein!“, rief ich empört, „Wo denkst du hin! Er würde niemals in meine Kammer steigen!“ Die Köchin verdrehte die Augen und schüttelte verständnislos den Kopf. „Er wird es tun, verlass dich drauf.“ „Was bedeutet das, Friedlinde, ‚bei mir liegen‘?“ Abrupt wandte sich Friedlinde ab und sagte unwirscher, als ich es von ihr gewohnt war: „Das weiß ich selbst nicht genau, Magdalena, denn bei mir hat noch kein Mann gelegen. Aber dass es Unzucht ist, wenn man es tut und nicht verheiratet ist oder nicht vom selben Stand, das weiß ich wohl. Du kannst dafür ins Gefängnis kommen, oder man klagt dich der Hexerei an, weil man behaupten wird, du hättest den Herren Medicus verführt. Willst du auf dem Scheiterhaufen enden?“ Mein Herz schlug mir bis zum Hals und um meine Brust schnürte es sich zu. Ich begann zu zittern. Scheiterhaufen? Hexerei? Gefängnis? Von diesen Dingen hatte ich gehört, aber was sollte das mit mir zu tun haben? Mit der wunderschönen Sache, die zwischen dem Herrn Medicus Braunert und mir geschehen war und immer noch geschah und nach der ich mich ‚verzehrte‘? „Magdalena“, sagte die Köchin noch einmal und sah mir dabei fest in die Augen, „versprich mir bitte, dass du dem Herren Medicus nicht gestatten wirst, bei dir zu liegen. Du wirst die Tür zu deiner Kammer verschließen.“ „Ich kann sie nicht verschließen, es gibt keinen Schlüssel“, wand ich ein. „Dann möge Gott dir gnädig sein“, sagte sie mit leiser Stimme. Sie klang noch viel trauriger als traurig, so als hätte aller Mut und alle Hoffnung sie mit einem Schlag verlassen. Und ich konnte es nicht verstehen, weshalb sie so traurig war.
Genau zwei Tage, nachdem Friedlinde mich zur Rede gestellt hatte, lag ich in meiner Kammer und hatte gerade die Kerze gelöscht, als ich die Stufen der steilen Treppe knarzen hörte. Ich spürte, dass er es war. Mein Herz begann vor Aufregung immer schneller zu schlagen, in meinem Kopf wirbelten Bilder durcheinander, Bilder von brennenden Scheiterhaufen und Frauen mit roten Haaren darauf, Augenpaare, die mich anstarrten, die von Friedlinde, vom Medicus Braunert, die meiner Mutter, schreckensgeweitet, so wie ich sie gesehen hatte, als sie in den Wehen lag. ‚Er darf nicht bei mir liegen‘, dachte ich. ‚Ich muss nur verhindern, dass er bei mir liegt‘, nahm ich mir vor. Schon öffnete sich die Tür zu meiner Kammer. Ich nahm die Umrisse seiner männlichen Gestalt wahr, seine breiten Schultern. Er trug nur sein Nachtgewand, ein langes, weißes Hemd mit Rüschenärmeln, darunter weiße Strümpfe. Sein langes, dunkelblondes Haar war zu einem Zopf gebunden. „Magdalena“, flüsterte er. „ich halte es nicht mehr aus“. Mein Herz klopfte zum Zerspringen. Ich spürte das Blut in meinen Adern pochen, und ich sprang aus dem Bett. Nun stand ich vor ihm, ebenfalls nur in mein Nachtgewand gekleidet. Er stand nur da. Es war eine Nacht, in welcher der Mond ganz voll und rund war und sein Licht durch das kleine Fenster schickte, und so konnte ich erkennen, dass er mich durchdringend anschaute. „Magdalena, wie wunderschön du bist. Lass mich dein Haar berühren und riechen“. Er trat einen Schritt auf mich zu und fuhr mit beiden Händen in mein Haar. Es war tagsüber zu einem strengen Zopf gebunden und unter meiner Haube versteckt gewesen, doch auf die Nacht hatte ich den Zopf gelöst, so dass meine dunklen Haare lockig über meine Schultern fielen. „Wie weich es ist und wie unglaublich gut es duftet“, murmelte er und sog den Geruch tief ein. Ich stand fast regungslos da und spürte, wie seine Hände mein Gesicht behutsam umschlossen. In meinem Kopf begann sich alles zu drehen, aber ich war unfähig, die Gedanken in Worte zu fassen, geschweige denn, diese über die Lippen zu bringen. Der Medicus nahm meine Hand und trat auf meine Bettstelle zu, um mich dorthin zu ziehen.
Ich zögerte unsicher, blieb stehen, woraufhin er mich fragend anblickte. „Magdalena, ich halte es nicht mehr aus“, wiederholte er seine Worte. „Wir dürfen das nicht tun!“, entfuhr es mir. Ich sah, dass sein Blick fragend war. „Es ist nicht rechtens. Wir dürfen nicht beieinander liegen“, erklärte ich mit Nachdruck und war erleichtert, dass ich diese Worte hatte aussprechen können. „Ich tue nichts, was du nicht möchtest, das verspreche ich dir“, sagte er leise und zog sanft, aber mit Nachdruck an meiner Hand. Zögernd tat ich einen kleinen Schritt, dann noch einen, dann stand ich vor meiner Bettstelle. „Wo ist die Herrin?“, fragte ich misstrauisch, denn es schien mir mehr als verwunderlich, dass er mitten in der Nacht zu mir in die Kammer kam, während seine Frau allein in dem gemeinsamen Bett lag. „Sie hat mich um ein Schlafmittel gebeten, da sie starke Unterleibsschmerzen hatte, und mein Trank aus Mohn, Veilchenöl und Bilsenkraut ist für seine gute Wirkung bekannt,“ raunte er mir ins Ohr. Dabei berührten seine Lippen sanft mein Ohr, und wohlige Schauer jagten über meinen Körper. Und während er das sagte, setzte er sich auf die Kante meines Bettes und zog mich zu sich auf seinen Schoß. Ich wusste nicht, wie mir geschah, doch war ich gleichsam beruhigt, dass wir auf diese Weise nicht beieinander lagen, sondern saßen. Zwischen seinen Beinen spürte ich etwas Hartes, da wo sein Geschlecht war. Ich hatte meine Brüder nackt gesehen und konnte mir denken, wie ein Mann zwischen den Beinen aussah. Der Medicus hielt mich in seinen Armen und neigte seinen Kopf zu mir, um mich mit seinem Mund zu liebkosen.
Ich konnte nicht anders, als diese Zärtlichkeit zu erwidern und ließ mich in seine Umarmung fallen. Dass die Hände eines Mannes so liebevoll und sanft sein konnten, hatte ich nicht gewusst. In seinen Augen lag ein warmer Glanz, der durch das sanfte Licht des Mondes einen schimmernden Zauber bekam. „Du bist wunderschön, Magdalena“, flüsterte er und blickte mich andächtig an. Behutsam fuhr er mit seinem Zeigefinger über meine Augenbrauen, meine Wangenknochen, meine Lippen, meine Nase, mein Kinn, so als würde er mein Gesicht malen. Da fing mein Herz auf unerhörte Weise an zu hüpfen, so als würde es gleich in meiner Brust zerspringen, und ich konnte für Augenblicke kaum noch atmen. „Wir dürfen nicht beieinander liegen“, stieß ich hervor, als er sich nach hinten legte und mich mit sich zog. „Ich tue nichts, was du nicht auch willst, Magdalena.“
Wir lagen auf der Seite, und er hielt mich vor seinem Körper. Sein Atem ging schnell, und ich spürte, dass auch sein Herz wild schlug, und doch tat er nichts, als mich nur zu halten. ‚Wir dürfen nicht beieinander liegen‘, dachte ich, Friedlinde hat mich gewarnt‘, hämmerte es in mir. Weshalb durfte es nicht sein, wenn es doch so schön war? Ich fühlte mich so warm und geborgen in seinen Armen, neben seinem Körper liegend, und es war ja nichts geschehen, was in meinen Augen ‚unzüchtig‘ gewesen sein könnte. Dennoch waren da diese Zweifel. Es fühlte sich an, als würde ich immerzu von einer zur anderen Seite gerissen. Was war richtig, was war falsch? „Wir dürfen das nicht tun“, sagte ich erneut, doch er machte nur „Sshhhh, bitte nicht, mein Herz, zerstöre nicht den Augenblick, nach dem ich mich so lange schon sehne.“ So lagen wir da und schwiegen und hielten uns. Ich spürte, dass da ein Verlangen nach ‚mehr‘ war, wenngleich ich nicht wusste, welches ‚Mehr‘ da wartete. Doch ahnte ich, dass es etwas mit seinem und meinem Geschlecht zu tun haben musste, und ich spürte, wie es dort sehnsüchtig pochte und brannte. Dieser Schritt wäre die Grenze, die wir nicht übertreten durften, das sagte mir meine Vernunft. Und er respektierte diese Grenze, er berührte mich nicht unsittlich, er hielt mich und wiegte mich sanft in seinen Armen, und nach einiger Zeit stand er auf und sagte: „Ich muss wieder zu meiner Frau gehen, Magdalena, sie darf nichts von uns wissen.“ Bevor er ging, beugte er sich noch einmal zu mir und gab mir einen Kuss, der mir all seine innige Zärtlichkeit und Sehnsucht offenbarte. „Schlaf gut, mein Herz“, sagte er sanft, und dann ging er. ‚Mein Herz‘, hatte er gesagt. Sagte er das auch zu seiner Frau? Lag er auch bei ihr in dieser Weise? In mir war alles aufgewühlt. Ihn bei mir liegen zu haben, war wunderschön gewesen. Und obgleich ich wusste, dass es nicht sein durfte, wünschte ich mir, er würde es wieder tun.
5. Kapitel
Sie ist nun da, mir ganz nah. Noch kann sie mich nicht wahrnehmen, doch ich finde einen Weg. Sie wird mir helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Die Tür zum Lehrerzimmer stand offen, und so trat Liz zögernd ein. Da waren drei oder vier Lehrerinnen und auch zwei Lehrer, die emsig in Unterlagen vertieft waren, an ihren Tischen Stapel umsortierten oder frisch kopierte Materialien umhertrugen. Unwillkürlich huschte ihr ein Lächeln über das Gesicht. Es war doch überall gleich. Lehrer waren Jäger und Sammler, ewige Horter und Sortierer, und grundsätzlich niemals fertig, weil es immer was zu tun gab.
Eine Frau mittleren Alters blickte zufällig in ihre Richtung und schlussfolgerte sogleich, dass es sich bei ihr um die neue, junge Kollegin aus Karlsruhe handeln musste, frisch aus dem Referendariat, ein Küken also. Sie ging auf Liz zu und begrüßte sie mit einem entwaffnenden Lächeln. „Hallo, du bist die Neue, stimmt’s? Ich bin die Beate und freue mich, dass du jetzt hier bist.“ Liz lächelte zurück und stellte sich vor. „Ja, ich bin schon sehr gespannt auf meine neue Schule“, fügte sie noch hinzu. „Ach, wir sind ein richtig tolles Team. Wir haben nette Kinder und engagierte Eltern, das wirst du schnell merken“, schwärmte sie. „Komm, ich zeige dir, wo dein Platz ist.“ Im Lehrerzimmer ihrer alten Schule waren alle Tische in einem großen U gestanden, und jeder Lehrer hatte an seinem Platz ein bis mehrere Stapel mit Papieren, Büchern und Ordnern gehabt, also eigentlich ziemlich chaotisch. An der Mulfinger Schule war das anders gelöst, hier hatte jeder Lehrer einen eigenen Arbeitsplatz mit kleinem Rollcontainer darunter, und in der Mitte des Raumes stand ein runder Tisch, um den herum sich alle setzen konnten. Das sah freundlich aus.
Beate ging Liz voran und genoss es sichtlich, der neuen Kollegin den zukünftigen Platz zu zeigen. Da es keine riesige Schule war, war das Kollegium überschaubar. Wer sie inzwischen wahrgenommen hatte, hatte ihr freundlich zugenickt. „Die Konferenz findet im Musiksaal statt, da haben wir mehr Platz“, erklärte Beate. „Ich zeige dir alles, komm einfach mit“. Liz war erleichtert und froh zugleich, dass sich Beate für sie verantwortlich fühlte und sie ein bisschen unter ihre Fittiche nahm. Der erste Eindruck war entscheidend, und der war durchweg positiv, dachte sie zufrieden. Liz setzte sich auf einen der noch freien Plätze und holte ihr Mäppchen und ihr großes Notizbuch heraus. Darin hielt sie alles fest, was wichtig war: Protokolle, Unterrichtsskizzen, Notizen, Termine. Ihre erste Aufregung hatte sich schon ein wenig gelegt, als nach und nach alle Kolleginnen und Kollegen eintrudelten.
Der Schulleiter war ein älterer Mann mit grauen Haaren, einer deutlich erkennbar beginnenden Glatze und einer kleinen runden Brille, die er zum Lesen ganz vor auf die Nasenspitze schob. Er trat zu Liz und begrüßte sie mit Handschlag. „Guten Morgen, Frau Breitner, mein Name ist Köhler und ich leite diese Schule.“ Liz erhob sich und erwiderte den Gruß. „Ich würde sagen: Herzlich willkommen im Team. Die Formalitäten können wir nach der Konferenz besprechen, der Hausmeister gibt Ihnen dann auch die Schlüssel. Sie werden im kommenden Schuljahr die vierte Klasse einer Kollegin übernehmen, die durch Schwangerschaft ausfällt.“ Liz schluckte. Eine vierte Klasse, das war eine große Aufgabe gleich zu Beginn. Sie hatte bisher in einer zweiten Klasse Deutsch unterrichtet und viel Fachunterricht in Musik. Mit einer vierten Klasse hatte sie noch keinerlei Erfahrung. Das war gleich eine große Verantwortung, eine Abschlussklasse zu übernehmen, und sie schwankte zwischen ‚sich geehrt fühlen‘ und dem Zweifel, ob sie dieser Aufgabe überhaupt schon gewachsen war. Doch Herr Köhler machte zwar einen freundlichen Eindruck, strahlte aber zugleich eine Autorität aus, die keinen Widerspruch duldete.
Liz straffte die Schultern, nickte höflich und blickte freundlich in die Runde, denn sie merkte durchaus, dass sie jetzt von allen neugierig gemustert wurde. ‚Sei einfach du selbst‘, hatte Oma Doro gesagt. Nun begann ein neuer Abschnitt für sie. Sie würde die Herausforderung annehmen, und sie würde es meistern. Das wäre doch gelacht. Als Herr Köhler sie bat, sich vorzustellen, räusperte sie sich kurz und sagte: „Ja, hallo. Also ich freue mich sehr, dass ich nun hier an der Grundschule in Mulfingen sein darf. Mein Referendariat habe ich in Karlsruhe gemacht, wo ich auch studiert habe. Meine Schwerpunktfächer sind Deutsch, Geschichte und Musik, aber ich freue mich darauf, möglichst viele Fächer in meiner Klasse zu unterrichten. Ach ja, ich wohne in Mäusberg, und ich finde, es ist ein ganz bezauberndes … ähm… kleines Dorf… An die Stille muss ich mich noch ein wenig gewöhnen, an den Dialekt auch, aber ich bin sicher, es wird.“ Liz sah das Kollegium schmunzeln und spürte, dass das Eis gebrochen war.
In den kommenden zwei Stunden versuchte sie sich auf das zu konzentrieren, was der Schulleiter erzählte, doch sie spürte, wie eine fast bleierne Müdigkeit in ihr hochzukriechen begann und nahm sich vor, sich mittags ein wenig hinzulegen. Liz übernahm den Posten der „Fachfrau für Sachunterricht“, weil sie das mit Schwerpunkt Geschichte studiert hatte, und weil schließlich jeder im Kollegium irgendeine Aufgabe übernehmen musste. Die Lehrer bekamen ihre neuen Stundenpläne ausgeteilt, die Tagebücher für die Klasse, allerhand anderen Schriftkram, der zu Schuljahresbeginn einfach erledigt und abgehakt werden musste, und Liz hatte das Gefühl, als läge ein unüberwindbarer Berg an Aufgaben vor ihr. „In der ersten Schulwoche findet wie immer Klassenlehrerunterricht statt. Gehen sie mit der Klasse wandern, schließen Sie sich mit Parallelkollegen zusammen, damit das Problem der Begleitperson gelöst ist. Denken Sie auch daran, die Termine für die Klassenpflegschaftsabende frühzeitig festzulegen und abzustimmen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes restliches Wochenende und sehe Sie dann am Montag um 8.30 Uhr hier pünktlich zum Schulbeginn.“ Mit diesen Worten schloss er die Konferenz, alle klopften beifallsbezeugend auf den Tisch und erhoben sich, um sich augenblicklich wieder in ihre Vorbereitung zu stürzen.
Liz stand etwas unschlüssig herum. Da kam zum Glück Beate, stieß sie aufmunternd mit dem Ellenbogen in die Seite und sagte: „Weißt du was? Du holst jetzt schnell deine Schlüssel beim Köhler, und dann zeige ich dir dein Klassenzimmer und alles andere, was du wissen musst.“ Erleichtert ließ sich Liz von der netten Kollegin dirigieren. Sie bekam gegen ihre Unterschrift den Schlüssel fürs Schulhaus und für ihren Rollcontainer im Lehrerzimmer, noch ein Formblatt für ihre Personalakte, und dann zeigte Beate ihr das ganze Schulhaus, vom Lehrmittelzimmer über den Kopierraum bis hin zu den Toiletten. „Deine Klasse ist total lieb, es sind nur 18 Kinder. Ihre Klassenlehrerin musste früher als erwartet gehen, weil es Komplikationen in der Schwangerschaft gab, und sie hatten jetzt fast vier Monate nur Krankheitsvertreter. Die werden alle sehr froh und dankbar sein, wenn jetzt endlich wieder etwas Kontinuität in den Laden kommt.“ Liz warf einen Blick in das Zimmer der Viertklässler. Erleichtert stellte sie fest, dass es von ihrer Vorgängerin sehr freundlich eingerichtet war und sie hier einfach erstmal starten konnte. Auf den Fensterbänken reihten sich viele Pflanzen, es gab eine gemütliche Leseecke, und alles wirkte ordentlich und strukturiert. An den Wänden hingen übersichtliche Lernplakate, es gab einen „Dienste-Plan“ mit Namensschildern der Kinder, und als Liz die Namen überflog, stellte sie überrascht fest, dass kein einziger Name nach Migrationshintergrund klang. „Gibt es noch eine zweite vierte Klasse?“, wollte Liz wissen. „Ja, der Klassenlehrer heißt Herr Birnaz. Er legt Wert darauf, gesiezt zu werden, aber das darfst du nicht persönlich nehmen. Im Grunde ist er ein netter Mensch, aber eben ein Lehrer der alten Schule, wenn du verstehst, was ich meine“, und dabei zwinkerte Beate Liz zu.
Um zu verdeutlichen, was sie damit gemeint hatte, schloss Beate das Klassenzimmer von Liz‘ künftigem Parallelkollegen auf, und da bot sich ihr ein ganz anderes Bild. Das Zimmer sah aus, als hätte man vor 40 Jahren einfach die Zeit angehalten. Eine Grünlilie fristete ihr Solodasein auf dem Lehrerpult, die Tische standen streng hintereinander in Reih und Glied, an den Wänden hingen ein paar vergilbte Regelplakate aus dem Deutsch -und Mathematikunterricht und eine Tafel mit den Buchstaben der lateinischen Ausgangsschrift. Außerdem stand ein altes Klavier in der Ecke, seitlich vom Lehrerpult. „Gehört das Klavier der Schule?“, wollte Liz wissen. Beate zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Das steht schon seit ich an der Schule bin immer nur beim Birnaz im Zimmer. Eins muss man ihm lassen, er singt sehr viel mit seinen Klassen.“ Das gefiel Liz gut. Sie selbst liebte die Musik. Und sie spielte zwar auch Klavier, doch begleitete sie die Lieder in der Schule eigentlich am liebsten mit der Gitarre, weil man damit einfach mobiler war. Sie war gespannt auf ihren Kollegen, der jedoch leider, wie sie bedauernd feststellen musste, unmittelbar nach der Konferenz verschwunden war. Beate erzählte Liz noch so dies und das, was man in der ersten Schulwoche alles bedenken musste und sicherte ihre Unterstützung zu. Sie selbst würde erst am Donnerstag loslegen, da sie eine erste Klasse bekäme.
Liz beschloss, erst einmal alles sacken zu lassen und in ihre Wohnung zu fahren. Das wuselige Treiben der Kollegen machte sie ganz nervös. Sie musste jetzt erst einmal in Ruhe überlegen, was diese vierte Klasse für sie bedeutete und wie der erste Schultag mit der Klasse aussehen sollte. Aber der erste Eindruck von der neuen Schule, den Kollegen und den Räumen war durchweg positiv. ‚Der erste Eindruck ist schließlich das, was zählt‘, dachte sie. Leider war sie so müde, dass sie sich am liebsten augenblicklich an Ort und Stelle einfach nur noch hinlegen wollte. Und so schnappte sie sich lediglich die Schulbücher, mit denen sie ab sofort unterrichten würde, und fuhr dann nach Hause. ‚Nach Hause‘, dachte sie, ‚wie sich das anhört.‘ Aber tatsächlich fühlte es sich schon ein kleines bisschen so an, wie Zuhause.
Als sie in die Einfahrt einbog, wo sie ihren Stellplatz hatte, zuckte sie zusammen. Da stand Marcels Auto. Liz war überrascht und zugleich verunsichert. Sie konnte gar nicht sagen, ob sie sich wirklich von ganzem Herzen darüber freute, dass ihr Freund gekommen war, um ihr einen Besuch abzustatten. Denn er hatte nichts angedeutet. Um ehrlich zu sein, war sie sich nicht einmal mehr sicher, wie ihr aktueller Beziehungsstatus lautete.
Ich hatte nun also bei einem Mann gelegen oder ein Mann hatte bei mir gelegen, und ich wusste, dass es da noch mehr geben musste, und dass dieses ‚Mehr‘ genau die Grenze war, vor der mich die Köchin gewarnt hatte. Es kam in den folgenden Tagen und Wochen immer regelmäßiger vor, dass mein Herr zu mir in die Kammer hinaufstieg. Es geschah immer dann, wenn seine Frau unpässlich war und nach einem Trank verlangt hatte, welcher sie in einen tiefen Schlaf versetzte.
Der Medicus hielt sein Versprechen, er bekräftigte es von Mal zu Mal aufs Neue, und er tat nichts, was ich nicht wollte. Sein Anblick war mir so lieb und vertraut geworden, wenn er des nachts vor mir stand, und schon war ich es, die ihm die Hand reichte, und ihn auf die Bettstelle zog. Seine Hände waren sanft und zärtlich, und wir küssten und berührten uns an vielen Stellen unseres Körpers, doch hatte ich es nicht zugelassen, dass wir diese Grenze überschritten.
Nur einmal noch hatte mich Friedlinde beiseite gezogen und eindringliche Warnungen ausgesprochen, und ich hatte ihr abermals versichert, es nicht zuzulassen. „Das sagen sie alle, und dann ist plötzlich ein Balg in ihren Leib gepflanzt“, hatte sie verächtlich gezischt und sich abgewandt. Es tat weh, die mir so vertraut und lieb gewordene alte Köchin derart enttäuscht zu sehen, doch war das ‚Verzehren‘ von so großer Macht, war dieses brennende Verlangen nach der Nähe des Herren Medicus so stark, dass es sich durch nichts aufhalten ließ. Immer wieder musste ich an die biblische Geschichte von Adam und Eva denken, die im Garten Eden von dem Baum der verbotenen Früchte gegessen hatten, weil sie nicht stark genug gewesen waren, der Verlockung zu widerstehen, und ich wusste, dass genau diese Verlockung es war, der auch ich nicht widerstand.
An einem Abend im Winter, als es draußen so kalt war, dass der Atem in meiner Schlafkammer fast in der Luft gefror, da zog mein Herr mich so dicht an sich, dass ich seine Erregung genau an der Stelle spürte, wo für mich bisher die Grenze gewesen war. „Ich halte es nicht länger aus, Magdalena“, stöhnte er leise und begann sich zu bewegen und an mir zu reiben, und ich spürte ebenfalls ein Verlangen nach ihm, wie nie zuvor. Ich war unsicher, was nun geschehen würde, aber aus irgendeinem Grund wusste ich, dass wir die Grenze überschreiten würden. So geschah es, dass wir ineinander verschmolzen, voller Hingabe und Zärtlichkeit, und es fühlte sich nicht falsch an in diesem Moment, sondern vollkommen und wunderschön, als hätten wir endlich zusammengefügt, was ohnehin zusammengehörte. Doch unmittelbar ‚danach‘ begann der Medicus zu jammern: „Ich hätte es nicht zulassen dürfen. „Aber es war schön“, sagte ich. „Es darf nicht passieren, dass du schwanger wirst,“ sagte er. Ich erschrak zutiefst, als er das aussprach, und die Bilder meiner Mutter traten mir vor die Augen, wie sie in den Wehen gelegen hatte und alles voller Blut gewesen war, und wie sie geschrien und gestöhnt hatte. Ich erinnerte mich, wie ich sie immer und immer wieder mit gewölbtem Leib gesehen hatte, der anzeigte, dass bald ein weiterer Säugling käme, ein weiteres hungriges Maul in unserer Familie, das kaum zu stopfen war, kaum dass es von der Mutterbrust entwöhnt sein würde.
Jetzt wusste ich, was Friedlinde gemeint hatte, als sie von einem Balg gesprochen hatte, welches in meinen Leib gepflanzt würde. So also ging das, wenn ein Mann und eine Frau wirklich beieinander lagen. „Weshalb habt Ihr es denn getan, wenn Ihr es nicht zulassen dürft?“, wollte ich wissen. „Weshalb kommt Ihr Abend für Abend in meine Kammer?“ Der Herr Medicus seufzte schwer und strich mir mit seiner Hand zärtlich über den Kopf. „Ich kann nicht anders, ich liebe dich, Magdalena“, sagte er leise. „Ich denke von morgens bis abends nur an dich und deinen wunderschönen Körper. Ich habe deinen Duft in der Nase, und deine Augen leuchten in meinem Herzen. Mir ist erst wohl, wenn ich dich sehe und berühren und halten darf“, sprach er weiter. Seine Stimme schien in mir zu vibrieren und ich schmiegte mich behaglich an seinen Körper. „Dennoch darf es nicht passieren, denn ich habe bereits mit einer anderen Frau den Bund der Ehe geschlossen.“ „Liebt Ihr sie auch?“, wollte ich wissen. „Nein, bis ich dich getroffen habe, wusste ich nicht, was wirkliche Liebe ist, mein Herz“. „Ist das der Grund, weshalb Eure Frau noch kein Kind bekommen hat?“, fragte ich weiter. „Das ist möglich. Wenngleich wir uns redlich bemüht haben, die ehelichen Pflichten und die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen.“ Mit diesen Worten legte er mir seinen Finger auf den Mund als Zeichen, dass ich nicht weiter fragen sollte.
Nach dieser Nacht wartete ich einige Abende vergeblich auf meinen Herren Medicus, und auch tagsüber im Haus spürte ich, wie er mir auswich. Zugleich spürte ich das Misstrauen meiner Herrin. Ihre Blicke drangen wie glühende Nadeln in mein Herz, und ich konnte es ihr nicht verdenken. ‚Was nützt ihr das große Haus und das viele Geld‘, dachte ich, ‚wenn sie nie erfahren wird, was Liebe bedeutet?‘. Ich lag in meiner Kammer und blickte zur Decke und lauschte in das Dunkel der Nacht, sehnte das Knarren der Treppe herbei und stellte mir vor, wie er vor mir stand und neben mir lag und in mir war, und dabei zerfloss ich fast vor brennendem Verlangen.
So war es nicht verwunderlich, dass jede Faser meines Körpers nach ihm lechzte, als er schließlich nach endlos scheinenden Tagen eines Abends wieder zu mir kam. Ich spürte, wie erregt er war, erregt und nervös zugleich. Mein Mund schien plötzlich wie ausgetrocknet und ich fühlte mich außerstande, auch nur ein Wort zu sprechen. Auch er gab keinen Ton von sich. Wie zwei ausgehungerte Tiere fielen wir uns in die Arme und übereinander her, als hätten wir beide unendlich viel aufzuholen. „Ich bin beinahe gestorben vor Sehnsucht nach dir“, keuchte er schließlich völlig außer Atem. Und dann zog er unter seinem Nachthemd etwas hervor, was ich mir nicht erklären konnte. „Damit, meine Liebe“, erklärte er triumphierend und hielt eine fast durchsichtige Blase in die Höhe, die einem Stück Schweinedarm ähnelte, „damit werden wir künftig verhindern, dass bei unserem Liebesspiel ein Kind gezeugt wird.“ Mein Herz klopfte fast zum Zerspringen. Wie genau er diese Schutzhülle um seine Männlichkeit legte, entzog sich meinen Blicken, aber sie schien ihren Zweck zu erfüllen, war sie doch nach unserem Beisammensein stets gefüllt mit einer milchig weißen Flüssigkeit. Genauso heimlich, wie er diese Schutzhülle mit in meine Kammer gebracht hatte, nahm er sie auch wieder mit. So konnten wir beide beruhigt sein und uns unserer Leidenschaft hingeben.
Die Tage und Wochen zogen ins Land, und es hätte eigentlich alles so weitergehen können, hätte mich nicht eines Tages Friedlinde beiseite gezogen und mich unverblümt gefragt: „Magdalena, hast du noch alle vier Wochen deinen Blutfluss?“ Ihre Worte ließen mich erstarren, und mein entsetzter Blick genügte ihr. „Deine Brüste sind so prall, wie ich sie noch nie gesehen habe, und dein Bauch wölbt sich unter der Schürze, und das kommt nicht vom vielen Essen“, stellte sie mit hochgezogenen Augenbrauen fest. Ich spürte, wie mir heiß und kalt zugleich wurde. Es war mir in der Tat aufgefallen, dass mein Bauch sich zu wölben begonnen hatte, doch hatte ich dem keine Bedeutung beigemessen. Zudem hatten meine prallen Brüste dem Medicus so gut gefallen, dass ich mir eingebildet hatte, sie würden sich unter seinen zärtlichen Händen so üppig entfalten. An meinen Blutfluss hatte ich beileibe nicht mehr gedacht, war es ja immer nur eine äußerst lästige Angelegenheit gewesen. Natürlich wurde mir jetzt bewusst, dass ich mich offensichtlich in einer trügerischen Sicherheit gewogen hatte. „Wann war deine letzte Blutung, Magdalena?“, fragte mich Friedlinde. Ich versuchte, mich fieberhaft daran zu erinnern und wusste es nicht mehr genau. Verzweiflung, Wut und Enttäuschung über meine eigene Dummheit wallten in mir hoch, bis es schluchzend aus mir herausbrach: „Ich weiß es nicht mehr, Friedlinde, es muss vor Weihnachten gewesen sein.“ Die Köchin schüttelte fassungslos den Kopf und barg ihren Kopf in ihre faltigen, kleinen Hände. „Mädchen, Mädchen, wie soll das nur enden?“, jammerte sie. „Ich weiß es nicht, Friedlinde, ich weiß es nicht. Warum ist etwas nicht richtig, wenn es sich doch so gut anfühlt?“ Die Köchin nahm mich bei den Schultern und sah mir fest in die Augen. „Hör zu, Mädchen, du musst das so lange wie möglich verbergen. Keiner darf merken, dass du ein Kind erwartest. Hörst du? Das wäre eine große Schande, es ist Unzucht, Magdalena, die darf nicht ans Tageslicht gelangen.“
6. Kapitel
Sie weiß es noch nicht, doch sie hat mich wahrgenommen. Sie sucht nach Antworten auf Fragen, die ich ihr zu stellen beginne. Sie wird mir helfen.
Marcel saß auf der Terrasse, als Liz die Wohnungstür aufschloss. Er hatte einen Strauß roter Rosen mitgebracht, und sie wusste immer noch nicht, ob sie sich darüber freuen sollte. „Marcel…du…hier?“, sagte sie überrascht. Er stand auf und breitete die Arme aus. „Liz, ich war ein Idiot. Ich habe mich benommen wie ein kleines trotziges Kind. Bitte verzeih mir.“ Sie runzelte die Stirn, schaute weiterhin sehr fragend, erwiderte aber seine Umarmung und den Kuss zur Begrüßung. „Das mit dem trotzigen kleinen Kind hast du aber treffend formuliert“, stellte sie mit einem schelmischen Grinsen fest. Er gab ihr einen neckischen Stüber auf die Nasenspitze. „Nicht frech werden, Fräulein“, mahnte er. „Komm erst mal rein. Ich bin irgendwie total k.o. von der Konferenz und wollte mich gerade ein bisschen hinlegen“, erklärte sie.
Marcel zog irritiert die Augenbrauen hoch. „Du und hinlegen? Mitten am Tag? Das passt aber gar nicht zu dir.“ Liz zuckte die Schultern. „Ich schlafe zurzeit nachts sehr schlecht und bin tagsüber entsprechend müde.“ „Ach komm, ich mache uns jetzt einen Espresso, und dann erzählst du mir von deiner neuen Schule“, schlug Marcel vor und begann, ohne auf ihre Antwort zu warten, die kleine Espressokanne zu füllen und auf den Herd zu stellen. „Wo hast du deine Tassen?“, rief er aus der Küche, während Liz sich in Opas Sessel hatte fallen lassen. Sie hörte, wie er einen Schrank nach dem anderen öffnete und fand das irgendwie fast übergriffig, weil es doch ihre Wohnung war. Er hätte mit nach Hohenlohe ziehen können, aber er wollte lieber in Karlsruhe bleiben.
Als es schließlich in der kleinen Kanne blubberte und zischte und ein verführerischer Duft nach frisch gebrühtem Kaffee durch den Raum schwebte und Liz das Klappern von Geschirr hörte, wusste sie, dass er die Tassen gefunden hatte und es nun gleich seinen leckeren Espresso geben würde. Sie blieb einfach in ihrem Sessel sitzen und ließ sich bedienen. „In der Schublade neben dem Herd müssten Kekse sein, holst du die bitte noch?“, bat sie ihn. Und dann ließ sie sich die Mischung aus mürbem Gebäck und schmelzender Schokolade, abgerundet von aromatischem, starkem Espresso, auf der Zunge zergehen. „Mmhhh“, machte sie und schloss genießerisch die Augen. Marcel hatte sich auf die kleine Couch gesetzt und rührte gedankenverloren in seiner Tasse. Schließlich stand er auf, klatschte auffordernd in die Hände und fragte: „Na, Liz, was wollen wir heute Abend unternehmen? Ich bin vorbereitet. Der Tank ist gefüllt, wir können also gerne kilometerweit durch die Pampa fahren, um in eine halbwegs zivilisierte Gegend zu kommen. Hast du Lust, tanzen zu gehen? Möchtest du ins Kino? Ein Theater wird es hier nicht geben, vermute ich. Oder möchtest du lecker zum Essen gehen?“ Liz verdrehte innerlich die Augen, aber wollte ihren Freund nicht vor den Kopf stoßen. „Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich überhaupt etwas unternehmen möchte, Marcel. Ich bin so müde.“ Er sah Liz an und atmete genervt laut aus. „Wird man automatisch zum Stubenhocker, wenn man Landei ist?“, fragte er, und Liz fand, dass es ziemlich abfällig klang. „Ich bin doch kein Stubenhocker, nur weil ich erschöpft bin und mich gerne ein wenig ausruhen möchte, oder?“, hielt sie dagegen. „Außerdem muss ich mich doch auch auf meine neue Klasse und die erste Schulwoche vorbereiten. Ich weiß erst seit drei Stunden, dass ich eine vierte Klasse übernehmen soll. Weißt du, was eine vierte Klasse bed…“
Weiter kam sie nicht, denn Marcel fiel ihr barsch ins Wort: „Schule, Schule, Schule, immer nur Schule. Ihr Lehrer könnte nichts anderes, als an Schule zu denken und über Schule zu reden. Wozu bin ich eigentlich extra hergefahren?“ „Ich habe dich nicht gebeten, zu kommen!“, rief Liz. Sie war empört. Was fiel ihm eigentlich ein? Konnte er denn gar nicht verstehen, wie es ihr gerade ging? „Dann kann ich ja auch wieder gehen!“, brüllte er zurück. Er knallte seine Espressotasse auf den Tisch und stand auf. Vielleicht erwartete er, dass sie ihn aufhielt. Doch sie schaffte es nicht einmal, sich aus dem Sessel zu erheben. Wütend und enttäuscht rauschte er durch die offene Terrassentür und bog um die Ecke. Liz fühlte sich außerstande, irgendwie zu reagieren und lauschte auf den Moment, in dem er seinen Wagen starten würde. Noch einmal kam er um die Ecke gebogen, starrte sie wütend an, wie sie immer noch wie gelähmt in ihrem Sessel saß, rief: „Scheint dir ja wirklich völlig gleichgültig zu sein!“, schnappte den Strauß roter Rosen, der noch auf dem kleinen Tisch lag, schmiss die Blumen auf den Boden und zertrat die schönen roten Blütenköpfe mit den Füßen. Und dann ging er. Und er fuhr tatsächlich davon, mit aufheulendem Motor und dezent quietschenden Reifen. Liz saß immer noch da, starrte mit leerem Blick aus dem Fenster und sah die roten und grünen Blätter zerwühlt auf dem Boden liegen. Tränen liefen über ihre Wangen, und sie wusste in dem Augenblick, dass es nun endgültig vorbei war.
Von dem Augenblick an, als Friedlinde mich mit dem Gesicht auf die Wahrheit gestoßen hatte, die ich die ganzen Wochen und Monate nicht hatte sehen wollen, schien mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt zu sein. Ich wusste nicht mehr, wie ich dem Medicus Braunert unter die Augen treten sollte. Da war auf der einen Seite mein großes Verlangen nach seiner Nähe, doch auf der anderen Seite die Angst vor seiner Reaktion, wenn er bemerken würde, dass das geschehen war, was er hatte verhindern wollen. Wie lange würde ich es verbergen können? „Mein Mädchen“, sagte Friedlinde immer wieder, wenn ich mit gesenktem Kopf und eingezogenen Schultern meine Arbeit verrichtete, „es gibt immer einen Weg. Man muss ihn nur finden.“
Doch für mich schien zunächst alles aussichtslos. Wenn ich versuchte, einen vorsichtigen Gedanken in die nahe Zukunft zu fassen, war da nichts als Leere. Zum ersten Mal, seit ich im Hause des Medicus Braunert in Stellung gegangen war, sehnte ich mich nach meiner Familie und fragte mich, wie es meiner Mutter ging, ob sie schon wieder schwanger war und ob sie mir einen Rat geben könnte. Wie gerne hätte ich mich von ihr in ihre Arme schließen und mich trösten lassen. Auch wenn auf dem elterlichen Hof nicht viel Zeit für jedes einzelne Kind gewesen war, so waren doch die Eltern da gewesen. Jetzt war ich auf mich allein gestellt. Noch konnte ich den Bauch unter meinem Kleid verbergen. Aber wie lange noch würde ich es geheim halten können? „Wie lange trägt eine Frau das Kind im Bauch?“, wollte ich eines Tages von Friedlinde wissen. „Es sind 40 Wochen“, gab sie zur Antwort. „Und wie viele Male hat dein Blutfluss bereits ausgesetzt?“ Ich dachte noch einmal angestrengt nach, kam aber immer wieder auf die Zeit vor Weihnachten. Der Medicus hatte immer diese Schweinsblase benutzt und darin aufgefangen, was ‚dabei‘ aus ihm herauskam – immer, bis auf dieses eine allererste Mal. Und das war im Winter gewesen, in einer kalten Dezembernacht. Und seitdem waren der Januar, Februar, der März und der April ins Land gezogen, und der Mai war angebrochen mit seiner üppigen grünen Pracht. „Dein Kind wird im Herbst zur Welt kommen“, stellte Friedlinde fest.
Als mein Herr Medicus Braunert eines Abends wieder in meine Dachkammer trat, konnte ich ihn nicht ansehen. Ich lag auf meinem Bett und hatte ihm den Rücken zugewandt. „Magdalena, mein Herz, was ist nur los? Warum weichst du mir aus?“, fragte er, und in seiner Stimme war solch eine verzweifelte Traurigkeit, dass ich nicht anders konnte, als ihm reinen Wein einzuschenken. Ich drehte mich zu ihm um und hob mein Nachtgewand, um ihm meinen kleinen runden Bauch zu zeigen. Weil er mich fassungslos anstarrte, nahm ich seine Hand und legte sie auf die Wölbung. In genau diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, als würden in meinem Bauch hundert kleine Schmetterlinge mit ihren Flügeln schlagen und mich von innen sacht berühren. „Wie konnte das nur passieren?“, fragte der Medicus mit verzweifelt aufgerissenen Augen. „Ihr hattet doch diesen Schutz“, sagte ich. „Bis auf das eine Mal.“ Seine Worte kamen fast tonlos über seine Lippen, und ich sah, wie er mehrmals schlucken musste, ehe er weitersprechen konnte. „Es ist zu spät, um es wegmachen zu lassen. Weshalb hast du nichts gesagt, Magdalena?“, wollte er wissen. „Ich wusste es selbst nicht. Die Köchin hat mich darauf gebracht.“ „Die Köchin hat dich…“, stöhnte der Medicus laut auf. „Die Köchin hat dich darauf gebracht. Das heißt, wenn es die Köchin schon bemerkt hat, dann…“ Ich sah ihn fragend an. „Magdalena, wenn es selbst die alte Köchin schon bemerkt hat, was denkst du denn, wird meine Frau gesehen haben, die sich doch nichts sehnlicher wünscht, als endlich ein Kind zu bekommen?“
Ich konnte nichts erwidern. Was blieb mir denn zu sagen? Ich war es nicht allein gewesen, doch kam ich mir nun vor, als träfe mich die ganze Schuld. „Ihr könnt mich ja aus eurem Dienst entlassen“, sagte ich leise. „Was sollte ich meiner Frau als Grund dafür nennen?“, gab der Medicus zurück. „Sie würde noch misstrauischer werden, als sie ohnehin schon ist. Was würde sie dir für ein Zeugnis ausstellen? Wie willst du mit einem Kind im Leib und ohne Zeugnis eine neue Anstellung finden?“ Diese Worte versetzten mir einen schmerzhaften Stich. „Aber wie soll ich ein Kind verstecken?“, dachte ich laut nach, und dabei stiegen mir verzweifelte Tränen in die Augen.
Ich wusste, wie das war mit einem Säugling. Meine Mutter hatte sich die Kleinen immer in ein Tuch um den Körper gewickelt und trug sie entweder vor dem Bauch oder auf dem Rücken. So konnte sie ihre Arbeit verrichten und hatte das Kind dennoch bei sich. Doch es hatte auch Arbeiten gegeben, bei denen der Säugling nicht dabei sein konnte, und dann lag er in seiner Wiege und schrie aus Leibeskräften so lange, bis er vor Erschöpfung einschlief. Daher wusste ich auch, wie laut so ein kleines Wesen brüllen konnte, und ich fragte mich, ob diese Laute nicht auch bis in die Räume der Herrin dringen würden.
„Du wirst es nicht verstecken können, Magdalena“, sagte der Herr Medicus und rieb sich angestrengt mit der Hand über die Stirn, so als könnte er damit den rettenden Einfall herbeibeschwören. Auf einmal erhob er sich abrupt, öffnete die Tür und wollte schon aus der Kammer treten, als er sich noch einmal zu mir umdrehte. „Gib mir ein wenig Zeit, mein Herz, um eine Lösung zu finden“, sagte er. Ohne eine Umarmung, ohne einen Kuss ging er davon. Wie war mir schwer ums Herz, und wie unendlich einsam kam ich mir in dem Augenblick vor. Ich hatte das Gefühl, als wäre mir die Luft zum Atmen genommen, als würde sich ein enges, eisernes Band um mein Herz legen. In dieser Nacht konnte ich keinen Schlaf finden.
In den kommenden Tagen bekam ich den Herren Medicus nicht zu Gesicht. Er kam nicht mehr in meine Kammer hinauf, und ich begegnete ihm nicht mehr. Lediglich wenn ich das Essen servierte, saß er zu Tisch, doch hob er nicht den Blick, weder er noch seine Frau. Keiner von beiden sah mich an, und jedes Mal fühlte es sich an, als würde jemand mit einem Messer in meinem Bauch herumbohren. Es brannte und drückte und mein Hals schien wie zugeschnürt, so dass ich kein Wort herausbrächte, selbst wenn ich Antwort geben müsste. Ich fragte mich von morgens bis abends, was er dachte und fühlte, ob es ihm ähnlich ging wie mir. Doch weil er keinen einzigen Versuch mehr unternahm, mit mir zu sprechen, war ich mir sicher, dass seine Liebe in dem Moment, da er von dem Kind in meinem Bauch erfahren hatte, verstorben war. Von Zeit zu Zeit, wenn ich gar zu traurig dreinblickte, nahm mich Friedlinde in den Arm oder legte mir aufmunternd ihren dicken Arm um die Schulter. „Wir werden einen Weg finden, Mädchen“, sagte sie dann, doch spürte ich wohl, dass auch ihre Zuversicht dahinschmolz, je weiter die Zeit voranschritt und je runder mein Bäuchlein wurde.
Inzwischen konnte ich mein Kind spüren, denn es stieß mit seinen Ärmchen und Beinchen gegen meinen Bauch, dass mir manchmal fast die Luft zum Atmen wegblieb. Der Sommer war mit großer Hitze und Trockenheit in die Stadt gedrungen, und bald hatte man das Gefühl, als gäbe es keinen kühlen Winkel mehr. Selbst in den tiefen Kellern stand die Luft, und unter dem Dach war es ganz besonders schlimm. Wenn ich abends in meiner Kammer lag, legte ich meine Hände auf meinen Bauch, so dass ich die Haut spüren konnte, und dann sprach ich leise mit meinem Kind und erzählte ihm von meinem Tag. Mit jedem Tag, den ich es in meinem Leib trug, begann ich es mehr zu lieben und alsbald kam es mir vor, als könnte ich das Band spüren, mit dem das Kind mit mir verbunden war. Ich versuchte, mir vorzustellen, wie das Kind wohl aussehen würde. Dunkel erinnerte ich mich an die rosigen Wangen meiner jüngeren Geschwister, an den dunklen Flaum aus feinen Haaren, welcher ihre Köpfchen bedeckt hatte und an den allen Säuglingen eigenen Duft nach neuem Leben und Muttermilch. Von Zeit zu Zeit, meist wenn ich mich abends zur Ruhe legte, konnte ich durch meinen Bauch hindurch spüren, wie es dagegentrat. Und manches Mal bildeten sich kleine Beulen, und dann musste ich bei der Vorstellung lachen, wie da ein kleines, winziges Wesen in mir versuchte, Übungen zur Leibeskräftigung zu machen. Ob es dabei wohl die winzigen Hände zu Fäustchen geballt hatte? In diesen Augenblicken, wenn ich mich meinem Kind so nah und verbunden fühlte, konnte ich den Kummer vergessen, der mein Herz den Rest der Zeit so schwer machte.
7. Kapitel
In ihre Träume konnte ich bereits gelangen, doch weiß sie nicht, dass ich es bin, die mit ihr sprechen möchte. Ich sehe sie, wie sie keinen Schlaf finden kann. Ich möchte sie berühren und mitnehmen, um ihr noch mehr zu zeigen, damit sie versteht und damit ich verstehe.
Liz beschloss, eine Nachtschicht einzulegen. Nachdem Marcel gefahren war, war sie in ihrem Sessel sitzend so tief eingeschlafen, dass sie erst spät am Abend wieder aufgewacht war. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie wieder richtig bei Sinnen war und sich orientiert hatte. Was waren das für merkwürdige Träume, die sie ständig hatte. Sie konnte es überhaupt nicht richtig einordnen. Suchend lief sie in ihrer Wohnung umher, ging in die Küche und goss sich Wasser in ein Glas, das sie in einem Zug leerte. ‚Eigentlich müsste ich versuchen, diese Träume aufzuschreiben‘, dachte sie, doch sie konnte sich kaum erinnern, und nichts schien ihr wirklich greifbar. In ihrem Bauch begann es zu rumoren, und als ihr bewusst wurde, dass sie noch den ganzen Tag fast nichts gegessen hatte, fing sie erst einmal an, sich etwas zu essen zu machen. Nudeln mit Tomatensoße, das ging immer. Während die Nudeln im Salzwasser kochten, öffnete sie die Terrassentür und trat hinaus. Gedankenverloren legte sie ihre Hand auf den Bauch und atmete tief ein. Die Hand auf dem Bauch, das kam ihr bekannt vor. Bei wem hatte sie das neulich erst gesehen? Eine schwangere Frau, ihr war eine schwangere Frau begegnet. Aber wo? Oder hatte sie geträumt, sie selbst wäre schwanger? ‚Wie absurd ist das denn‘, dachte sie und schüttelte den Kopf. Ausgerechnet jetzt, wo sie ihren Freund davongejagt hatte, von Schwangerschaft zu träumen. Ihr Blick fiel auf die zertrampelten Rosen, und sie schämte sich, dass sie es so weit hatte kommen lassen. War sie zu unsensibel gewesen? Immerhin hatte sich Marcel auf den Weg gemacht, um sie zu überraschen. Weshalb nur hatte sie sich nicht richtig darüber freuen können? Liz atmete laut aus und holte dann einen Handfeger, um die Blüten-Blätter-Bescherung zu beseitigen. ‚Wann hat er mir das letzte Mal Rosen geschenkt?‘, überlegte sie. Und er hat sich entschuldigt‘, dachte sie, ‚er wollte sich eigentlich mit mir versöhnen‘. Je länger sie darüber nachdachte, desto schlechter fühlte sie sich, und als die Nudeln fertig waren, stocherte sie lustlos darin herum und hatte gar keinen richtigen Appetit mehr. Sie musste unbedingt mit jemandem darüber reden. Nur jetzt um diese Zeit, kurz vor Mitternacht, konnte sie schlecht irgendwo anrufen. Eva war ein sehr gewissenhafter Mensch, was regelmäßigen und ausreichenden Schlaf betraf. Ihre Mutter war noch nie eine gute Zuhörerin gewesen, am wenigsten was Beziehungsprobleme anging. Die Eltern fanden, Marcel sei eine gute Partie und gingen wahrscheinlich davon aus, dass eines Tages eine Einladung zur Hochzeit ins Haus flattern würde. Liz schob ihren Teller von sich und lehnte sich im Stuhl zurück. Vielleicht würde ihr ein kleiner Spaziergang jetzt guttun? Sie stellte den Teller in die Küche, schlüpfte in ihre Sneakers und dachte im letzten Moment noch an den Haustürschlüssel. Dann trat sie in die dunkle Septembernacht. Der Mond war halb zu sehen, und nach einiger Zeit hatten sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt, so dass sie die schmale Straße von der Wiese unterscheiden konnte. Nichts war zu hören als die Kühe, die mit ihren langen, rauen Zungen die Grasbüschel rupften. Liz konnte ihre Umrisse erkennen. Manche standen und drehten ihre Köpfe in die Richtung des nächtlichen Spaziergängers, manche lagen wiederkäuend da, andere bewegten sich bedächtig Schritt für Schritt über die Wiese und konzentrierten sich voll und ganz auf eine einzige Sache. Hektik schienen sie nicht zu kennen. ‚Man kann sich von den Tieren vieles abschauen‘, dachte Liz. Der Geruch der Tiere war ihr, seit sie hier wohnte, schon beinahe vertraut geworden. Plötzlich spürte sie einen kühlen Wind im Rücken. Irritiert drehte sie sich zu ihm, denn es bewegte sich weder ein Blatt an den Zweigen des Baumes, der neben ihr am Rand der Weide stand, noch bogen sich Gräser zur Seite. Vielmehr spürte sie den Wind wie einen Hauch ausschließlich in ihrem Rücken. Eiskalte Schauer jagten ihren Körper entlang. „Wer ist da?“, fragte sie laut in die Dunkelheit und kam sich schrecklich dumm vor, denn es war ganz offensichtlich, dass nur Rindviecher vor ihr standen. Doch als würde der Wind ihr antworten, strich er nun so um ihren Körper, als wolle er ihn einkreisen. Liz drehte sich, versuchte die Richtung zu orten, aus welcher dieser Luftzug kam, doch dieser schien sich mitzudrehen. Liz spürte ihr Herz bis zum Hals schlagen. Das war ihr doch ein bisschen unheimlich hier draußen. Schnell schlug sie wieder den Weg zu ihrer Wohnung ein. Ihr Herz hämmerte immer lauter und ihr Atem ging stoßweise. Sie beschleunigte ihre Schritte. Die Schuhe machten laute Geräusche auf dem Asphalt. Immer wieder drehte sie sich panisch um, ob jemand sie verfolgte. Doch es war niemand zu sehen, sie spürte nur diesen Wind, der mit ihr eilte und sie nicht entkommen ließ. Mit zitternden Fingern steckte sie den Schlüssel in ihre Haustür, schloss auf, schlüpfte hinein und knallte die Tür hinter sich zu. Als sie den Rücken an die Tür lehnte, versuchte sie, tief durchzuatmen und einen klaren Gedanken zu fassen. ‚Das war Einbildung‘, sagte sie sich, ‚Da war kein Wind.‘ Doch noch immer fühlte es sich an, als wäre sie da draußen nicht allein gewesen, mal abgesehen von den Kühen, als wäre da jemand oder etwas gewesen. ‚Es gibt keine Geister‘, sagte sie und versuchte mit aller Kraft, das Gefühl abzuschütteln, das ihr noch immer in den Gliedern steckte. Sie machte Licht und setzte sich nachdenklich in ihren geliebten Sessel. Was Marcel jetzt wohl gerade machte? Wahrscheinlich schlief er längst tief und fest. Er war so wütend gewesen, als er hier losgefahren war. ‚Hoffentlich ist ihm nichts passiert‘, dachte sie erschrocken, griff nach ihrem Handy und tippte eine Nachricht an ihn. ‚Das ist richtig dumm gelaufen, es tut mir leid. Ich war einfach so voller neuer Eindrücke und hatte das Gefühl, du kannst das gar nicht verstehen. Hoffe, du bist gut heimgekommen.‘ Liz zögerte, welche Grußformel sie verwenden sollte. ‚Liebe Grüße, Liz‘, das klang fast zu neutral. ‚Kuss, Liz‘ ging auch nicht, denn ihr war einfach nicht nach ‚Kuss‘, und Marcel vermutlich auch nicht. So schrieb sie gar nichts, drückte auf ‚Senden‘ und grübelte weiter. Da war so viel in ihrem Kopf, die vielen neuen Eindrücke der Schule und Kollegen, die Unterrichtsplanung, die sich wie ein Berg vor ihr auftürmte und dann diese seltsamen Träume, die sie nicht greifen konnte, aber in die sie Nacht für Nacht erneut eintauchte. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie da Einblick in eine andere Welt bekam, die ihr gar nicht mehr fremd vorkam, aber die noch so weit weg war, dass sie sich tagsüber nicht an Einzelheiten erinnern konnte. Doch was war das mit diesem Wind? War das Einbildung? Liz zögerte einen Augenblick, doch dann griff sie erneut zu ihrem Handy und googelte „Halluzination“. Sie hätte es besser nicht tun sollen, denn das Ergebnis war niederschmetternd direkt. ‚Als Halluzinationen bezeichnet man Sinnestäuschungen, die oft Anzeichen einer Psychose sind. Der Betroffene sieht, riecht, hört oder fühlt Dinge, die real nicht existieren.‘ Ihr wurde flau im Magen. Nein, sie war nicht verrückt, was für ein Nonsens. ‚Blödes Google‘, schimpfte sie leise vor sich hin, ‚macht einen onlinekrank‘. Liz gab sich einen Ruck und ging zu ihrem Schreibtisch, wo sie die Schulbücher für die vierte Klasse und den Stapel an Unterlagen aus ihrer Tasche packte, die sie an der Schule mitgenommen hatte. ‚An die Arbeit, Liz‘, murmelte sie. Es sollte schließlich ein gelungener Start mit der vierten Klasse werden.
Mein Bauch war rund und prall geworden, und die Arbeit war bisweilen ganz schön beschwerlich geworden. Friedlinde versuchte, mir die schweren Aufgaben abzunehmen, und es gab mir eine große Sicherheit, ihre fast mütterliche Sorge um mein Wohlergehen zu spüren. Natürlich würde sie das niemals zugeben, ihr Ton blieb ruppig und streng, und sie ließ mich deutlich merken, dass sie die Schwangerschaft nicht gutheißen konnte. Das Kind in meinem Bauch bestimmte bereits jetzt mein Leben. Es zwang mich, öfter stehen zu bleiben und zu verschnaufen, es versetzte mir bisweilen so unerhörte Tritte, dass ich auf die Lippen beißen musste, um nicht leise aufzuschreien vor Überraschung, und es machte, dass mir in der Sommerhitze schon bei der kleinsten Anstrengung der Schweiß von der Stirne rann.
Der Medicus wich mir nach wie vor aus. Es gab nur noch selten eine Begegnung zwischen ihm und mir. Einmal war er mir im Hof begegnet, als er von einem Patientenbesuch zurückkam und ich mit einem Korb nasser Wäsche aus der Waschküche kam. „Mein Herr“, sagte leise ich mit flehender Stimme, „weshalb weicht Ihr mir aus?“ Da sah er mir in die Augen, und ich erschrak, als ich ihn so sah: Sie waren rot gerändert vor Kummer und Gram, das sah man auf einen Blick. „Magdalena, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Meine Gattin weiß, was zwischen uns geschehen ist. Sie duldet diese Liebschaft nicht. Sie kommt aus einem einflussreichen Haus…“ Der Herr Medicus stockte und ich sah, wie er schlucken musste. „Ist denn alles vergessen, was zwischen uns war?“, wagte ich zu fragen. Fast unmerklich schüttelte er den Kopf. „Ich darf es nicht länger zulassen. Ich habe meiner Frau mein Wort gegeben. Und ich musste ihr noch mehr versprechen, Magdalena.“ Er blickte hastig um sich, als wollte er sich sicher sein, dass uns keiner beobachten konnte. Dann stellte er den schweren Korb auf den Boden und nahm meine Hand. Sehnsüchtig hauchte er einen Kuss darauf und sagte mit zitternder Stimme: „Magdalena, ich musste ihr versprechen, dass sie dein Kind bekommt.“
Entsetzt riss ich meine Hand aus der seinen. „Niemals!“, rief ich. „Niemals werde ich mein Kind hergeben! Das kann kein Mensch von mir verlangen. Das könnt auch Ihr nicht verlangen. Lieber sterbe ich.“ Der Medicus schüttelte verzweifelt den Kopf. „Sag so etwas nicht, Magdalena. Es ist die einzige Möglichkeit, die es gibt!“ „Das kann doch nicht die Lösung sein, nach der ihr suchtet!“ Abermals griff er nach meiner Hand. „Ich habe mir den Kopf zermartert, mein Herz. Ich sehe keinen Ausweg. Du wirst dein Kind in Sicherheit zur Welt bringen, du wirst es stillen und kannst es heranwachsen sehen. Es wird weder dir noch ihm an etwas fehlen. Meine Frau kann keine eigenen Kinder bekommen, sie ist bereit, es wie ihr eigenes Kind anzunehmen. Magdalena, du bist völlig mittellos. Du kannst das Kind nicht großziehen. So wäre jedem gedient.“ Ich spürte seine Verzweiflung und sah ihm seine Traurigkeit an. „Ich liebe dieses Kind, das ich unter meinem Herzen trage“, sagte ich, „und ich weiß nicht, ob ich es ertragen könnte, es aufwachsen zu sehen, aber ihm nicht die Mutter sein zu dürfen.“ Der Medicus atmete laut aus und zuckte ratlos die Schultern. „Ich habe keine andere Lösung gefunden, mein Herz. Auf Unzucht steht im schlimmsten Fall die Todesstrafe. Und die würde in dem Fall nicht mir drohen. Ich habe schon Frauen mit schwangeren Leibern am Galgen hängen oder auf dem Scheiterhaufen brennen sehen.“
Bei diesen Worten drehte sich mir der Magen um und eine Welle schrecklicher Übelkeit stieg in mir hoch. Ich musste mich abwenden und mich beinahe übergeben. Der Medicus berührte hilflos meinen Arm. „Magdalena, bitte beruhige dich. Es ist nicht gut, wenn du dich jetzt so aufregst“, sagte er. „In den nächsten Tagen werde ich eine Hebamme zu dir schicken, die eingeweiht ist. Sie hat genug Geld bekommen und weiß, über diese Sache zu schweigen. Meine Frau bereitet schon seit einigen Wochen alles für den Säugling vor. Er wird in einer schönen Wiege liegen und in feine Windeln gewickelt sein.“ Ich spürte, wie die Tränen kamen. „Das ist nicht recht“, schluchzte ich, „das ist nicht recht. Es ist doch unser Kind, mein Herr!“ „Sssshhhht“, sagte er und legte mir seinen Zeigefinger auf den Mund. „Es ist nicht recht, ich weiß es selbst, und es zerreißt mir fast das Herz, Magdalena. Aber ich weiß keine andere Lösung. Auf diese Weise wird es dir gutgehen und dem Kind an nichts fehlen. Bitte mach es mir nicht so schwer.“
Mit diesen Worten straffte er seine Schultern, atmete tief durch und nickte mir förmlich zu. ‚Wie kann er mir das antun? Wie kann er mir mein Kind nehmen wollen?‘, dachte ich und bückte mich, um den Korb mit Wäsche anzuheben. Da fuhr mir ein stechender Schmerz durch den Leib, und ich stöhnte laut auf und musste den Korb wieder fallen lassen. Der Medicus drehte sich um und kam zu mir zurück. „Was ist geschehen?“, wollte er wissen, und in seinem Blick lag große Sorge. Ich versuchte, tief Luft zu holen, doch der Schmerz kam in Wellen und schnürte mir die Stimme ab. Panik stieg in mir hoch, und ich klammerte mich an seinem Arm fest. „Magdalena, ich helfe dir jetzt in deine Kammer und hole dann die Hebamme. Ich denke, dein Kind hat es plötzlich sehr eilig.“ Erneut rollte eine Welle des Schmerzes durch meinen Körper, so als würde man mit einem Messer meinen Leib zerschneiden wollen, und ich stöhnte laut auf. „Ich kann nicht diese Stiege hinauf“, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. „Ich helfe dir, mein Herz, stütz dich auf“, versuchte der Medicus mir Mut zu machen. Als die Welle verebbt war und ich für Augenblicke wieder atmen konnte, gelang es mir, ein paar Schritte zu gehen.
Aus den Augenwinkeln konnte ich sehen, dass sich der schwere Vorhang im oberen Stockwerk bewegte, und ich vermutete, dass die Herrin dahinterstand und alles beobachtete. Doch schon kam die nächste Welle, und ich musste stehenbleiben und mich an ihn klammern. Es gelang mir, eine Atmung zu finden, mit der ich den Schmerz besser aushalten konnte. „Die Wehen haben eingesetzt, Magdalena, ich fürchte, du hast dich zu sehr aufgeregt“, sagte der Medicus. Nun war mir klar, woher die Wehen ihren Namen hatten. Wir kamen nur langsam voran, und wir mussten an den strengen Blicken der Herrin vorbei. „Es ist so weit, das Kind will auf die Welt kommen“, erklärte der Medicus seiner Frau, die sich uns mit vorwurfsvoll hochgezogenen Augenbrauen und vor der Brust verschränkten Armen in den Weg stellte. „Sie schafft es nicht in ihre Kammer“, keuchte er vor Anstrengung, „wir bringen sie in mein Behandlungszimmer.“
Doch die Herrin tat nichts, um mir zu helfen. Mit stechend kalten Blicken schien sie mich durchbohren zu wollen. Immer wieder musste ich stehenbleiben und stöhnte leise vor Schmerzen, bis die nächste Wehe vorüber war. Sie kamen in immer kürzeren Abständen. „Eine Erstgebärende liegt oft 24 Stunden und länger in den Wehen“, sagte die Herrin mit verächtlichem Tonfall. „Die Abstände sind bereits sehr kurz“, sagte der Medicus. „Ich kenne mich nicht mit Geburtshilfe aus, aber dass dieses Kind keine 24 Stunden mehr warten will, das sehe sogar ich.“ Ohne sich um seine Frau zu kümmern, half er mir, so gut er konnte und bettete mich auf den Boden. Dann lief er davon, um die Hebamme zu holen. Die Herrin stand in der Tür und schaute mir zu, wie ich mich in der nächsten Wehe krümmte. „Stell dich nicht so an. Das Kind gemacht habt ihr schließlich auch!“; herrschte sie mich an. Doch sie konnte mich nicht noch mehr verletzen als sie es ohnehin schon getan hatte.
Sie wollte mir mein Kind wegnehmen. Was konnte es für eine Mutter Schlimmeres geben? Ich konnte nichts anderes denken, als dass ich das Gefühl hatte, etwas würde mir den Leib zerschneiden, und ich hatte damit zu tun, gegen diese unbeschreiblichen Schmerzen zu atmen, um nicht ohnmächtig zu werden. Der Medicus musste auf dem Weg zur Hebamme Friedlinde Bescheid gegeben haben, denn diese kam herbeigeeilt, raffte ihre Röcke und beugte sich besorgt zu mir. Ich war so erleichtert, die Köchin in diesem Moment an meiner Seite zu haben, dass ich haltlos zu schluchzen begann. „Mein tapferes Mädchen, jetzt holen wir dein Kind auf die Welt“, sagte sie, und mit einem Blick auf die Herrin setzte sie nach: „Gnädige Frau Braunert, Ihr könnt beruhigt in euren Salon gehen, ich werde mich um Magdalena kümmern, bis die Hebamme zur Stelle ist.“ Bei der nächsten Wehe entfuhr mir ein Schrei, und ich krallte mich verzweifelt an Friedlinde fest. Ich hörte, wie die Herrin wütend schnaubte, dann aber davonrauschte.
„Die gnädige Frau brauchen wir ganz gewiss nicht bei der Entbindung“, sagte Friedlinde leise und strich mir eine Haarsträhne aus dem schweißnassen Gesicht. „Das tut so weh, Friedlinde, ich schaffe das nicht“, stöhnte ich. Ich war fest davon überzeugt, dass jetzt mein letztes Stündlein geschlagen hatte. Mein Puls raste, die Adern an den Schläfen traten blau hervor, wenn die nächste Wehe kam und mir beinahe den Atem nahm. Plötzlich bemerkte ich, wie es zwischen meinen Beinen nass wurde, und entsetzt griff ich mit der Hand dort hin. „Blut!“, schrie ich, noch bevor ich gesehen hatte, was es wirklich war. Friedlinde beugte sich hinunter und hob meinen Rock. „Nein, das ist nur Wasser, mein Mädchen“, sagte sie. „Wasser? Was für Wasser?“, wollte ich wissen, doch da rollte schon die nächste Wehe heran. Ich konnte sie kaum noch aushalten, da half auch keine Atmung mehr, und ich hatte den unbändigen Drang, zu pressen. „Friedlinde, ich sterbe!“; schrie ich, als der Schmerz mit der nächsten Wehe mit solcher Macht durch mich fuhr, dass mir wieder so übel war, als müsste ich mich augenblicklich übergeben. „Du stirbst nicht, Magdalena, du bekommst dein Kind!“, murmelte die Köchin. Ich war so froh und dankbar, dass sie bei mir war.
„Wo bleibt denn nur die Hebamme?“, fragte sie unruhig und hob noch einmal meinen Rock, um einen Blick zwischen meine Beine zu werfen. „Ich bin zwar keine Hebamme, aber wenn mich meine Augen nicht ganz täuschen, sehe ich bereits das Köpfchen“, rief sie erschrocken. „Ich kann nicht mehr, Friedlinde!“, schrie ich verzweifelt, als die nächste Wehe kam. Ich musste pressen, ich spürte, dass das Kind hinauswollte. Das Kind hatte es offensichtlich sehr eilig, meinen Leib zu verlassen. Ich presste mit ganzer Kraft, doch es reichte nicht. Mein Körper schien mitten durchzureißen, es brannte wie Feuer zwischen meinen Beinen, und da kam schon die nächste Wehe. Friedlinde hatte mir ein großes Kissen unter den Rücken, so dass mein Oberkörper nicht mehr flach auf dem Boden lag. Das half mir ein wenig, als die nächste Wehe kam. Wieder schaute sie nach, und Tränen der Rührung traten in ihre Augen. „Du schaffst es!“, rief sie, „Du schaffst es, ich kann es schon sehen!“ Sie nahm meine Hand und führte sie an die Stelle zwischen meinen Beinen, wo mein Körper gerade auseinandergerissen wurde.
Als ich sein Köpfchen fühlte, durchströmte mich mit einem Mal solch ein Glücksgefühl, dass ich noch einmal Bärenkräfte aufbrachte und bei der nächsten Wehe so kräftig presste, dass das Köpfchen meines Kindes herausgeschoben wurde. Die Wehe verebbte, und ich atmete keuchend. „Gleich ist es da, Magdalena!“, rief die Köchin. Unbeholfen versuchte sie, sich zwischen meinen Beinen nützlich zu machen, doch wusste sie nicht wie. Als die nächste Wehe kam und das Kind mit einem lauten, kämpferischen Schrei aus meinem Mund auf den Boden glitt, rauschte die Hebamme herein. „Jesus, Maria und Josef!“, hauchte sie, „da hatte es aber jemand eilig.“ Mit geübten Griffen nahm sie das Kind, band die Nabelschnur ab, wickelte es in ein Tuch und legte es mir auf den Bauch. Ich war beseelt vor Glück. Die Schmerzen waren vorbei und vergessen, als ich das winzige, blutverschmierte Bündel auf mir liegen hatte. Hektisch begannen die beiden Frauen, heißes Wasser und Tücher zu holen, um all das Unschöne, das aus mir herausgeflossen sein musste, zu beseitigen. Dann wurde das Kind gewaschen und gewickelt, was es gar nicht leiden mochte, denn es begann empört mit kräftiger Stimme zu schreien.
„Es ist ein Junge“, sagte die Hebamme, legte der gerührten Friedlinde den brüllenden Winzling in die Arme und untersuchte mich zwischen den Beinen. „Du bist gerissen, aber das wird heilen“, und sie wusch mich und beträufelte das, was an mir gerissen war, mit einer brennenden Flüssigkeit. Plötzlich spürte ich erneute Schmerzen, da kam noch eine Wehe. Mit angstvoll geweiteten Augen rief ich: „Da kommt ein zweites Kind!“ Doch die Hebamme lachte und schüttelte den Kopf. „Da kommt noch der Mutterkuchen. Den muss ich mir ansehen, ob er schön aussieht und vollständig ist.“ Ich spürte ein letztes Mal den Drang, zu pressen, doch waren die Schmerzen nur halb so schlimm, wie die zuvor. Mit der Nachgeburt schien die Hebamme zufrieden zu sein. „Ich zeige dir jetzt, wie du das Kind an deine Brust legen musst, damit du es stillen kannst“, erklärte sie mir. Ich nickte müde und erschöpft, aber überglücklich und schaute aufmerksam zu. Das kam mir alles sehr bekannt vor, denn ich hatte es schon hunderte Male bei meiner Mutter gesehen. Wie oft hatte sie während der Feldarbeit ein Brüderchen oder Schwesterchen angelegt und gestillt, wenn sie angefangen hatten, zu schreien, und kaum, dass sie fertig getrunken hatten, wurden sie wieder in das Tuch auf den Rücken oder vor die Brust gebunden. Die Arbeit musste ja weitergehen.
Die Hebamme verließ den Raum, um sich mit dem Herren Medicus und seiner Frau zu besprechen. Ich hörte gedämpfte Stimmen, konnte aber heraushören, dass die Hebamme etwas von ‚Wochenbett‘ und ‚Mutter und Kind‘ sagte. Wann würden sie mir dieses kleine Bündel Wunder, das da in meinen Armen und an meiner Brust lag, wegnehmen? Glück und Schmerz durchdrangen gleichzeitig mein Herz, und es fühlte sich an, als würde es zerreißen.